Ein positives Zukunftsszenario zu künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft
Abstrakt
Die digitale Paradoxie – Fortschritt ohne gesellschaftlichen Nutzen: Trotz massiver Investitionen in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) hat die westliche Welt in den vergangenen 25 Jahren weder ihre Produktivität spürbar gesteigert noch soziale Ungleichheit verringert oder die Erosion demokratischer Strukturen aufgehalten. Das sogenannte Produktivitätsparadoxon zeigt deutlich: Technologischer Fortschritt führt nicht zwangsläufig zu wirtschaftlichem oder gesellschaftlichem Wohlstand. Im Gegenteil – digitale Überwachung, algorithmische Diskriminierung und der Abbau intermediärer Institutionen haben neue Spannungen hervorgebracht.
Die strukturellen Fehlanreize aktueller KI-Geschäftsmodelle: Moderne KI-Systeme beruhen vielfach auf zentralisierter Datenextraktion und der Nutzung fremden geistigen Eigentums. Ihre Geschäftsmodelle begünstigen Machtkonzentration und digitale Abhängigkeit, anstatt Innovation und Fairness zu fördern. Selbst scheinbar neutrale Abonnement-Modelle verschleiern oft eine intransparente Verwertung persönlicher Daten. Die zugrunde liegenden Architekturen sind meist proprietär und untergraben sowohl die Datensouveränität der Nutzer als auch die faire Beteiligung von Urhebern an der Wertschöpfung.
Wissenschaftliche Gegenmodelle – Human-Centered AI: Internationale Expertinnen und Experten fordern einen Paradigmenwechsel hin zu menschenzentrierter Künstlicher Intelligenz (HCAI). Ziel ist es, Technologien nicht als Ersatz für menschliche Fähigkeiten zu sehen, sondern als deren Erweiterung. Daron Acemoglu kritisiert den derzeitigen Fokus auf Automatisierung und warnt vor einem ökonomischen Irrweg ohne nachhaltige Produktivitätsgewinne. Gary Marcus wiederum sieht in der Kombination aus menschlicher Logik und maschinellem Lernen das einzige tragfähige Zukunftsmodell – erklärbar, robust und ethisch verantwortbar.
Hybrid-HCAI: Die Vision einer kooperativen Intelligenz: Im Zentrum dieser Vision steht die Idee einer „Trihybriden Intelligenz“, die symbolische KI (Regeln, Logik), subsymbolische KI (neuronale Netze) und menschliche Kognition (Intuition, Ethik) miteinander verbindet. In dieser Architektur ist der Mensch nicht Objekt der Automatisierung, sondern integraler Bestandteil – aktiver Gestalter statt passiver Nutzer. Symbolische KI übernimmt eine vermittelnde Rolle: Sie reguliert die Kommunikation und sorgt für transparente, nachvollziehbare und ethisch verantwortbare Entscheidungsprozesse. Biologische und soziale Systeme dienen als Vorbild: Sie funktionieren durch dezentrale Interaktion, kontinuierliches Feedback, Anpassungsfähigkeit und emergente Strukturen. Diese Prinzipien könnten in ein symbolisches Regelwerk übertragen werden, das die Mensch-KI-Kooperation evolutionär steuert – selbstorganisiert, fair und kontextsensibel.
Ein konkretes Zukunftsszenario für Unternehmen: Unternehmen der Zukunft nutzen Hybrid-HCAI-Plattformen, die Arbeitsplätze dynamisch an Aufgaben und Kontexte anpassen. Prozesse, Regeln und Feedback werden kontinuierlich in einem hybriden Wissensgraphen aktualisiert. Lernen und Wandel erfolgen dabei organisch – ohne klassische Change-Prozesse. Mitarbeitende wirken durch dialogische Interaktion aktiv an der Weiterentwicklung des Systems mit. Die Organisation wird zum digitalen Echtzeit-Zwilling, der Prozesse simuliert, steuert und gemeinsam mit den Menschen weiterentwickelt. Der Arbeitsplatz wird so zum digitalen Spiegelbild des Individuums. Hybrid-HCAI ermöglicht eine neue Form betrieblicher Wertschöpfung: weniger bürokratischer Aufwand, höhere Innovationsgeschwindigkeit und strukturelle Resilienz. Gleichzeitig stärkt es die kulturelle Integrität – durch partizipative Entscheidungsprozesse, transparente Regeln und die faire Honorierung kognitiver Leistungen.
Vom KI-Produkt zum gesellschaftlichen Betriebssystem: Die Vision mündet in der Idee eines Open-HCAI – einer ethisch kodierten, dezentralen und öffentlich zugänglichen KI-Plattform. Ähnlich wie Bitcoin als dezentral gesteuerten Währungsinfrastruktur, könnte Open-HCAI zur grundlegenden Infrastruktur für Wissen, Innovation und gesellschaftliche Fairness werden. Eine solche Plattform wäre nicht nur eine technische Lösung, sondern Ausdruck einer neuen sozialen Grammatik: kollektive Intelligenz, Vertrauen und Teilhabe als Basis für produktive Wertschöpfung. Open-HCAI könnte zudem ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) sein – jedoch nicht als isolierte Superintelligenz, sondern als ko-evolutionäre Symbiose von Mensch und Maschine. Eine solche AGI wäre nicht nur leistungsfähig, sondern auch ethisch verankert, transparent und gesellschaftlich legitimiert.
Fazit – Ethische Regeln im Code: Die Zukunft der KI liegt nicht im Ersatz des Menschen, sondern in seiner aktiven Einbindung. Die Trihybrid-Intelligenz verbindet technologische Leistungsfähigkeit mit menschlicher Kognition, Transparenz und Teilhabe. Gelingt die Umsetzung dieser Idee, könnte eine gerechtere, produktivere und nachhaltigere digitale Gesellschaft entstehen. Ein frei verfügbares, dezentral gesteuertes Hybrid-HCAI („Open-HCAI“) könnte den Wettbewerb um exklusive KI-Assets obsolet machen – mit tiefgreifenden Veränderungen an den Finanzmärkten, in den Arbeitswelten und in der geopolitischen Machtbalance. Offen zugängliche Intelligenz demokratisiert Innovation, erfordert jedoch neue globale Governance-Regeln, um Fairness, Datenschutz und Inklusion zu gewährleisten. Die wahre Innovation liegt im ethischen Design – und in der Fähigkeit, technologische Macht in menschliche Würde und gesellschaftlichen Nutzen zu übersetzen.
(Friedrich Schieck / 07/2025)
Inhaltsverzeichnis
- Entwicklungen in der digitalen Ära
- KI-Geschäftsmodelle und strukturelle Probleme der digitalen Transformation
- Perspektiven aus der Wissenschaft zur Zukunft von KI
- AGI und der gesunde Menschenverstand
- Unterschiedliche Stärken von menschlicher und künstlicher Intelligenz
- Die Idee der „Hybrid-Intelligenz“
- Kollektive Intelligenz auf einem neuen Niveau
- Human-in-the-Loop und neuro-symbolische Ansätze
- Die Idee einer „Hybrid-HCAI“ – Ein Gedankenexperiment
- Ein neuro-symbolisches Regelwerk zur ultimativen Symbiose
- Hybrid-HCAI in Unternehmen – Ein Blick in die Zukunft
- Nutzenpotenziale einer Hybrid-HCAI-Plattform
- Auswirkungen einer Hybrid-HCAI auf Wirtschaft und Gesellschaft
- Beziehung zum Konzept der Artificial General Intelligence (AGI)
- Open-HCAI – Ein hypothetisches Gedankenexperiment
- Auswirkungen einer Open-HCAI für unsere Zukunft
- Meine vorläufigen Schlussfolgerungen
- Mein Statement
1. Entwicklungen in der digitalen Ära
Die vergangenen 25 Jahre haben in der westlichen Welt eine paradoxe Entwicklung offenbart: Trotz beispielloser Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der aufkommenden künstlichen Intelligenz sind zentrale gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Probleme nicht gelöst, sondern teilweise sogar verschärft worden.
Das anhaltende Produktivitätsparadoxon
Das bereits 1987 von Robert Solow beschriebene Produktivitätsparadoxon hat sich hartnäckig gehalten und in den letzten Jahren sogar verstärkt. Während Unternehmen und Staaten Hunderte von Milliarden in Digitalisierung, Automatisierung und KI-Systeme investiert haben, blieb das erwartete Produktivitätswachstum aus. Stattdessen stagnierten die Produktivitätszuwächse in vielen westlichen Ländern auf historisch niedrigem Niveau.
Die Ursachen sind vielschichtig: Viele Digitalisierungsprojekte scheitern an mangelnder Integration bestehender Systeme, führen zu Überadministration oder erfordern das kostspielige Parallelbetreiben alter und neuer Infrastrukturen. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsformen, die eher Stress und Ablenkung als echte Effizienzgewinne erzeugen – permanente Erreichbarkeit, Multitasking und digitale Überwachung belasten Arbeitnehmer, ohne die versprochenen Produktivitätssteigerungen zu liefern.
Demokratischer Rückschritt und autoritäre Tendenzen
Besonders alarmierend ist die Erosion demokratischer Institutionen in Ländern, die lange als stabile Demokratien galten. Digitale Technologien haben diese Entwicklung nicht verhindert, sondern oft beschleunigt. Soziale Medien und ihre Algorithmen ermöglichen die gezielte Verbreitung von Desinformation und schaffen parallele Realitäten, die eine gemeinsame Faktenbasis für demokratische Diskurse untergraben.
Populistische Politiker nutzen diese Plattformen für emotionalisierte Mobilisierung und gesellschaftliche Polarisierung. Gleichzeitig entstehen durch digitale Überwachungstechnologien neue Formen der politischen Kontrolle. Was ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelt wurde, wird zunehmend zur Überwachung politischer Opposition und zur Einschränkung bürgerlicher Freiheiten eingesetzt.
Traditionell wichtige intermediäre Institutionen wie unabhängige Medien und etablierte Parteien verlieren an Einfluss, während Tech-Konzerne faktisch journalistische und politische Gatekeeper-Funktionen übernehmen, ohne entsprechende demokratische Rechenschaftspflicht.
Verfall von Chancengleichheit und wachsende Ungleichheit
Die digitale Revolution hat bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten nicht nur nicht beseitigt, sondern neue Formen der Benachteiligung geschaffen. Eine digitale Spaltung durchzieht die Gesellschaft: Während privilegierte Schichten von KI-Tools, Automatisierung und digitalen Geschäftsmodellen profitieren, werden Arbeitsplätze mittlerer Qualifikation systematisch wegrationalisiert.
Der Zugang zu hochwertiger digitaler Bildung und Infrastruktur bestimmt zunehmend die Lebenschancen. Der entstehende Plattformkapitalismus konzentriert Gewinne bei wenigen Tech-Konzernen und deren Aktionären, während die Nutzer, deren Daten den eigentlichen Wert schaffen, nicht angemessen entlohnt werden.
Algorithmic-Management-Systeme treffen wichtige Entscheidungen über Kreditvergabe, Jobchancen und Sozialleistungen, perpetuieren dabei aber oft bestehende Vorurteile und schaffen neue, weniger transparente Formen der Diskriminierung. Die Gig-Economy hat Millionen von Arbeitnehmern in prekäre, formal selbstständige, aber faktisch abhängige Beschäftigungsverhältnisse gedrängt, ohne traditionelle Arbeitnehmerrechte oder soziale Absicherung.
Realer Wohlstandsverlust trotz digitalen Fortschritts
Paradoxerweise haben viele Menschen in westlichen Gesellschaften trotz der digitalen Revolution reale Wohlstandseinbußen erlitten. Zwar erscheinen digitale Services oft kostenlos, sie finanzieren sich jedoch durch Datenextraktion, Werbung und psychologische Manipulation, deren volkswirtschaftliche Kosten externalisiert werden.
Die Finanzialisierung der Wirtschaft, verstärkt durch algorithmischen Handel und spekulative Tech-Bewertungen, hat Wohlstand von der produktiven Realwirtschaft weg zu bereits Vermögenden umverteilt. Geografisch entstanden extreme Ungleichgewichte: Technologiezentren wie das Silicon Valley konzentrieren enormen Wohlstand, während traditionelle Industrieregionen abgehängt wurden – eine räumliche Polarisierung, die politische Spannungen anheizt.
Stagnierende Realeinkommen wurden teilweise durch leicht verfügbare Konsumkredite über Fintech-Plattformen kompensiert, was zu steigender Haushaltsverschuldung führte.
Systemische Verstärkung der Probleme
Diese drei Problemkomplexe – Produktivitätsparadoxon, demokratischer Rückschritt und wachsende Ungleichheit – verstärken sich gegenseitig in einem Teufelskreis. Ausbleibendes Produktivitätswachstum erzeugt ökonomischen Druck und macht autoritäre „Effizienzlösungen“ politisch attraktiv. Wachsende wirtschaftliche Ungleichheit untergräbt das Vertrauen der Menschen in demokratische Institutionen und deren Reformfähigkeit. Autoritäre Tendenzen wiederum behindern die notwendigen strukturellen Reformen zur Lösung der wirtschaftlichen Grundprobleme, da sie oft kurzfristige Machterhaltung über langfristige Problemlösung stellen.
Die Ironie dieser Entwicklung liegt darin, dass Technologien, die ursprünglich Effizienz steigern, Transparenz schaffen und demokratische Teilhabe fördern sollten, teilweise das Gegenteil bewirkt haben. Diese Erkenntnis wirft grundlegende Fragen über die gesellschaftliche Steuerung und demokratische Kontrolle technologischen Wandels auf und macht deutlich, dass bisheriger technischer Fortschritt allein nicht automatisch zu gesellschaftlichem Fortschritt führt.
2. KI-Geschäftsmodelle und strukturelle Probleme der digitalen Transformation
Die paradoxen Entwicklungen der vergangenen 25 Jahre – stagnierende Produktivität trotz massiver Technologieinvestitionen, demokratischer Rückschritt bei gleichzeitig verbesserter Kommunikationstechnologie und wachsende Ungleichheit im digitalen Zeitalter – lassen sich nicht allein durch ineffiziente Implementierung erklären. Vielmehr deuten sie auf grundlegende strukturelle Probleme sowohl in den technologischen Architekturansätzen als auch in den Geschäftsmodellen der dominierenden Technologieunternehmen hin.
Die Geschäftsmodelle der KI-Giganten
Die aktuellen KI-Anbieter verfolgen unterschiedliche, aber strukturell ähnliche Geschäftsmodelle, die alle auf zentralisierte Kontrolle und Datenextraktion setzen. OpenAI mit ChatGPT hat ein hybrides Modell entwickelt, das auf Subscription-Gebühren und API-Zugang basiert und mittlerweile zehn Milliarden Dollar jährliche Umsätze generiert, mit dem Ziel, bis 2025 12,7 Milliarden Dollar zu erreichen. Trotz dieser enormen Umsätze ist das Unternehmen aufgrund der gewaltigen Trainings- und Infrastrukturkosten noch nicht profitabel.
Kritiker wie Gary Marcus beschreiben das Geschäftsmodell von OpenAI drastischer: In seinem Beitrag „OpenAI Cries Foul“ vom 09.01.2025 charakterisiert er es als ein Unternehmen, das sich einen Namen gemacht hat, indem es „zerkleinerte Teile des geistigen Eigentums auf statistisch wahrscheinliche Weise ohne angemessene Entschädigung wiederkäute und neu kombiniert“ [1]. Diese Einschätzung verweist auf ein grundlegendes Problem der KI-Industrie: die massive Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte für das Training von Modellen, ohne die ursprünglichen Urheber zu entschädigen.
Google integriert seine KI-Technologie Gemini strategisch in sein etabliertes werbebasiertes Geschäftsmodell und nutzt KI-Services, um Suchergebnisse und Anzeigen präziser zu gestalten, während Google Cloud bereits eine 36-Milliarden-Dollar-Umsatzrate erreicht hat. Elon Musks xAI mit Grok verfolgt noch kein klares Monetarisierungsmodell und fungiert primär als strategisches Asset für das X-Ökosystem.
Strukturelle Kontinuität statt Innovation
Diese Geschäftsmodelle reproduzieren und verstärken die problematischen Strukturen der Plattformökonomie, anstatt sie zu durchbrechen. Selbst die scheinbar „saubereren“ Subscription-Modelle basieren weiterhin auf Datenextraktion für Modellverbesserung, schaffen neue Abhängigkeiten durch proprietäre Ökosysteme und bleiben intransparent bezüglich Trainingsmethoden und Datenverwendung.
Besonders problematisch ist dabei die systematische Aneignung geistigen Eigentums: KI-Unternehmen trainieren ihre Modelle unter anderem mit urheberrechtlich geschützten Texten, Bildern und anderen Inhalten, ohne die Urheber zu entschädigen oder auch nur zu fragen. Diese Praxis stellt faktisch eine Enteignung kreativer Arbeit dar, bei der die Wertschöpfung von den ursprünglichen Schöpfern zu den KI-Unternehmen umverteilt wird.
Die technologische Architektur folgt einem zentralistischen Kontroll-Paradigma: Alle Datenverarbeitung erfolgt in proprietären Cloud-Systemen, Nutzer haben keine Kontrolle über ihre Daten oder deren Verwendung, die Systeme funktionieren als undurchsichtige „Black Boxes“ ohne nachvollziehbare oder korrigierbare Entscheidungslogiken.
Die Ursachen der Paradoxie
Die Ursache für die paradoxen Entwicklungen liegt in der Kombination zweier sich verstärkender Faktoren: methodische und architektonische Defizite sowie problematische Geschäftsmodelle. Die aktuellen Technologieansätze fokussieren sich weiterhin auf fremdorganisierte Automatisierung, Überwachung und Steuerung, ob im unternehmerischen oder öffentlichen Bereich, anstatt Menschen zu ermächtigen oder demokratische Teilhabe zu fördern.
Gleichzeitig sammeln Plattformunternehmen persönliche Daten der Nutzer ohne explizite Zustimmung und verkaufen diese meistbietend an Dritte zu Werbezwecken. KI-Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter: Sie eignen sich systematisch die kreative und intellektuelle Arbeit von Millionen von Urhebern an, ohne diese zu entschädigen, und monetarisieren diese Inhalte über ihre KI-Services. Diese Kombination aus Datenextraktion und geistiger Enteignung schafft Systeme, die zwar technisch fortschrittlich sind, aber gesellschaftlich regressiv wirken und bestehende Machtungleichgewichte verschärfen.
Alternative Entwicklungspfade
Es existieren durchaus alternative Ansätze, die demokratischer und nutzerorientierter wären. Dezentrale KI-Architekturen könnten Modelle ermöglichen, die lokal auf Nutzergeräten laufen oder in föderalen Netzwerken ohne zentrale Kontrolle operieren. Open-Source-Entwicklung würde transparente, community-gesteuerte KI-Entwicklung statt proprietärer Systeme fördern. Konzepte der Daten-Souveränität könnten Architekturen schaffen, in denen Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten und deren Verwendung selbst bestimmen. Kooperative Geschäftsmodelle für KI-Infrastruktur könnten eine Alternative zu den aktuellen Monopolstrukturen bieten.
Systematische Machtkonzentration
Das Kernproblem liegt darin, dass die aktuellen KI-Entwicklungen die bestehenden Machtstrukturen der Plattformökonomie nicht nur nicht durchbrechen, sondern sogar verstärken. Anstatt Werkzeuge zu schaffen, die Menschen ermächtigen und demokratische Prozesse stärken, entstehen Systeme, die neue Abhängigkeiten schaffen und bestehende Ungleichheiten verfestigen. Die KI-Revolution folgt bisher demselben Muster wie die vorangegangenen Digitalisierungswellen: Technologische Innovation wird durch Geschäftsmodelle kanalisiert und kannibalisiert, die primär der Kapital- und Machtkonzentration bei wenigen Akteuren dienen.
Fazit:
Solange KI-Systeme nach etablierten Mustern entwickelt werden, werden sie die paradoxen Effekte der letzten 25 Jahre eher verstärken als auflösen, da KI-Unternehmen nicht nur Nutzerdaten extrahieren, sondern auch das geistige Eigentum von Millionen von Urhebern für ihre Modelle verwenden. Dies stellt eine neue Form der Enteignung dar, die über die bereits bekannten Probleme der Plattformökonomie hinausgeht, die Machtkonzentration weiter verschärft sowie die Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit einer freien Marktwirtschaft und liberalen Demokratie einschränken oder sogar außer Kraft setzen kann.
Damit stellt sich die erste Kernfrage:
Wie könnte ein grundlegender Paradigmenwechsel in den Methoden- und Architekturansätzen heutiger KI-Modelle aussehen, dass die kognitive Leistung des Nutzers honoriert und die Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit einer freien Marktwirtschaft und liberalen Demokratie fördert und nicht einschränkt?
3. Perspektiven aus der Wissenschaft zur Zukunft von KI
Eine Gruppe von 26 internationalen Experten veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Studie „Six Human-Centered Artificial Intelligence Grand Challenges” vom 02 Jan 2023.
Der weit verbreitete Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) hat erhebliche Auswirkungen auf das menschliche Leben, die noch nicht genau bekannt sind. Negative unbeabsichtigte Folgen gibt es zuhauf, darunter die Aufrechterhaltung und Verschärfung gesellschaftlicher Ungleichheiten und Spaltungen durch algorithmische Entscheidungsfindung.
Die Autoren stellen sechs große Herausforderungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft vor, um KI-Technologien zu entwickeln, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das heißt ethisch vertretbar und fair sind und das menschliche Dasein verbessern.
Diese großen Herausforderungen sind das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Regierung und stellen die übereinstimmenden Ansichten einer Gruppe von 26 Experten auf dem Gebiet der menschenzentrierten künstlichen Intelligenz (HCAI) dar.
Im Wesentlichen plädieren diese Herausforderungen für einen menschenzentrierten Ansatz in der KI, der:
- das menschliche Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt,
- verantwortungsvoll gestaltet ist,
- die Privatsphäre respektiert,
- menschenzentrierten Gestaltungsprinzipien folgt,
- einer angemessenen Steuerung und Aufsicht unterliegen und
- mit Individuen interagiert, während die kognitiven Fähigkeiten des Menschen respektiert werden.
‚
Die Autoren hoffen, dass diese Herausforderungen und die damit verbundenen Forschungsrichtungen als Aufruf zum Handeln dienen, um Forschung und Entwicklung im Bereich der KI zu betreiben, die als Multiplikator für fairere, gerechtere und nachhaltigere Gesellschaften dient. [2]
Daron Acemoglus Warnung vor der aktuellen KI-Entwicklung
Daron Acemoglu [3] (Wirtschaftsnobelpreisträger 2024) warnt in seinem Beitrag „Die Welt braucht eine pro menschliche KI Agenda“ vom 29. November 2024, dass künstliche Intelligenz (KI) im aktuellen Technologiekontext zu einer Welt führen könnte, in der vor allem Arbeitskräfte verdrängt und Menschen mithilfe von Manipulation und Fehlinformationen beeinflusst werden – ohne nennenswerte Produktivitätsgewinne. [4]
Obwohl einige Branchenexperten einen raschen Durchbruch Richtung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) prophezeien, weist Acemoglu darauf hin, dass es dafür bislang weder eindeutige Belege noch reale Produktivitätssteigerungen gibt. Statt KI vorrangig zur Automatisierung und zum Ersatz menschlicher Arbeitskraft einzusetzen, sollte sie Menschen vielmehr gezielt unterstützen und deren Fähigkeiten erweitern.
Um jedoch eine „pro-menschliche“ Agenda zu fördern, müssten Politik, Gesellschaft und Medien stärker darauf drängen, dass KI gezielt zur Stärkung menschlicher Kompetenzen entwickelt wird. Letztlich brauche es ein Umdenken, das sich von der Jagd nach AGI löst und KI in erster Linie als Werkzeug zur Verbesserung und Ergänzung menschlicher Arbeit betrachtet. [4]
Peter Dizikes bringt das in seinem Beitrag „Daron Acemoglu: Was wissen wir über die Ökonomie der KI?“ vom 6. Dezember 2024 wie folgt auf den Punkt: Bei allem Gerede über künstliche Intelligenz, die die Welt auf den Kopf stellt, bleiben ihre wirtschaftlichen Auswirkungen ungewiss. Es gibt massive Investitionen in KI, aber wenig Klarheit darüber, was sie produzieren wird.
„Woher kommen die neuen Aufgaben für den Menschen mit generativer KI?“, fragt Acemoglu. „Ich glaube nicht, dass wir diese kennen, und das ist es, was das Problem ist. Welche Apps werden die Art und Weise, wie wir Dinge tun, wirklich verändern?“ [5]
In seinem Beitrag „Werden wir die KI-Möglichkeit verspielen?“ vom 19. Februar 2025 verweist Daron Acemoglu darauf, dass seit mehr als 200.000 Jahren Menschen Lösungen für neue Herausforderungen bauen, vor denen sie stehen, und Wissen miteinander teilen. KI könnte diesen Trend fortsetzen, indem sie die menschlichen Fähigkeiten ergänzt und es uns ermöglicht, unser volles Potenzial auszuschöpfen, aber die Technologie entwickelt sich in eine andere Richtung. [6]
Gary Marcus‘ Kritik an aktuellen KI-Entwicklungen
Gary Marcus (emeritierter Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der New York University), einer der bekanntesten Kritiker aktueller Entwicklungen im KI-Umfeld, warnt in seinem Buch „Taming Silicon Valley How We Can Ensure that AI Works for Us“ sowie in einer Vielzahl von Beiträgen auf seinem Substack Blog vor den aktuellen Entwicklungen:
Generative KI wird oft als nächster großer Durchbruch gehandelt. Bewertungen gehen von gigantischen Märkten aus, obwohl die Einnahmen bisher nur im Bereich einiger Hundert Millionen liegen. Wichtige Einnahmequellen sind das automatische Schreiben von Code und Marketingtexte. Doch die überzogenen Erwartungen könnten zu einer massiven Blase führen, da die Technologie derzeit häufig hinter den Versprechungen zurückbleibt.
Ein zentrales Problem generativer KI sind sogenannte Halluzinationen – die Systeme erfinden Fakten oder liefern ungenaue Informationen. Auch fehlt es an Beständigkeit und „gesundem Menschenverstand“. Viele Fälle zeigen, dass KI-Modelle zwar statistische Muster erkennen, aber kein wirkliches Verständnis der realen Welt besitzen.
Das Problem, Maschinen eine alltägliche Menschenlogik beizubringen, ist seit den 1950er Jahren bekannt und ungelöst. Modelle wie ChatGPT oder Bild-KI-Systeme wie Sora kranken daran, dass sie zwar beeindruckende Ergebnisse erzeugen, aber grundlegende physikalische oder soziale Zusammenhänge oft nicht richtig verstehen. Es fehlt ihnen der gesunde Menschenverstand!
Die aktuelle Technologie kann schnelle und spektakuläre Fortschritte zeigen, ist jedoch wirtschaftlich und technisch instabil. Studien belegen, dass generative KI große Lücken bei formaler Argumentation und Abstraktionsfähigkeit hat. Experten wie Gary Marcus plädieren für einen neuro-symbolischen Ansatz, der statistische Verfahren mit symbolischer Logik kombiniert. Nur so könne langfristig eine KI entstehen, die wirklich verlässlich und breit anwendbar ist. [7]
In diesem Kontext schreibt Gary Marcus in seinem Blog-Beitrag „Deep learning is hitting a wall“ vom 9. Februar 2025: „Bei all den Herausforderungen in den Bereichen Ethik und Informatik und dem Wissen, das aus Bereichen wie Linguistik, Psychologie, Anthropologie und Neurowissenschaften und nicht nur aus Mathematik und Informatik benötigt wird, wird es ein ganzes Dorf brauchen, um zu einer KI aufzuwachsen. Wir sollten nie vergessen, dass das menschliche Gehirn vielleicht das komplizierteste System im bekannten Universum ist; Wenn wir etwas aufbauen wollen, das in etwa gleichwertig ist, ist eine offenherzige Zusammenarbeit der Schlüssel.“ [8]
In seinem Beitrag „A knockout blow for LLMs?“ vom 8. Juni 2025 schreibt Gary Marcus: „Die Vision von AGI, die ich schon immer hatte, ist eine, die die Stärken des Menschen mit der Stärke der Maschinen verbindet und die Schwächen des Menschen überwindet.“ [9]
4. AGI und der gesunde Menschenverstand
Artificial General Intelligence (AGI), deutsch künstliche allgemeine Intelligenz, ist die Intelligenz eines hypothetischen Computerprogramms, welches die Fähigkeit besitzt, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu lernen, die ein Mensch ausführen kann. Eine alternative Definition bezeichnet AGI als hochautonomes KI-System, welches bei der Lösung der meisten wirtschaftlich bedeutenden intellektuellen Aufgaben menschliche Fähigkeiten übertrifft. [10]
In diesem Sinne sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass die gigantischen Investitionen in KI-Modelle und KI-Infrastrukturen, welche die menschliche Intelligenz nachbilden oder übertreffen sollen, in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis stehen können, da menschliche Intelligenz in ausreichender Zahl und zu geringen Kosten weltweit verfügbar ist!
Ein Rechenexempel zur Veranschaulichung
In diesem Sinne habe ich ChatGPT-4o die hypothetische Frage gestellt: Wie hoch wären Investitionen und Energieverbrauch, um die Gehirn-Rechenleistung von einer Million Menschen mittels heutiger Supercomputer wie NVIDIA H100 GPU nachzubilden?
- Antwort ChatGPT4o – Zusammenfassung:
Kategorie | Wert |
FLOPs pro Gehirn | 10¹⁶ |
Gesamte Rechenleistung | 10 ZettaFLOPs |
GPUs benötigt (H100) | 167 Mio |
Rechenleistung pro GPU | 60 TFLOPs (FP64, realistisch) |
GPU-Kosten (nur Hardware) | ~5 Billionen USD |
Gesamtkosten mit Infrastruktur | ~5,15 Billionen USD |
Stromverbrauch | 167 GW |
Jährlicher Energiebedarf | ca. 1.460.000 GWh |
Jährlicher Energiebedarf Deutschland | ca. 449.800 GWh |
Selbst wenn diese Zahlen sehr hypothetisch sind, stellen sie doch die bisherigen und vor allem zukünftigen Investitionen in Weiterentwicklung und Training der GenAI/LLM-Modelle sowie in die erforderlichen KI-Infrastrukturen grundsätzlich in Frage. Ich glaube eher, dass die öffentliche Diskussion über die Möglichkeit, ein solches AGI-System entwickeln zu können, nur Marketingzwecken dient, um Investoren davon zu überzeugen, weiteres Kapital zu investieren.
Ich denke, KI-Forscher und Wissenschaftler sollten sich eher darüber Gedanken machen, wie man die kognitive Leistung menschlicher Gehirne in zukünftige KI-Modelle mit einbezieht!
5. Unterschiedliche Stärken von menschlicher und künstlicher Intelligenz
Menschliche Intelligenz ist biologisch und durch evolutionäre Anpassungen sowie soziale Erfahrungen geprägt. Sie äußert sich in kreativen, emotionalen und intuitiven Fähigkeiten, die es Menschen ermöglichen, Wissen kontextbezogen anzuwenden, neue Ideen zu entwickeln und aus Fehlern zu lernen. Darüber hinaus besitzen Menschen Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zu moralischen Entscheidungen. Ihre kognitiven Fähigkeiten – wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Kreativität und emotionale Intelligenz – sind einzigartig. Diese erlauben es, auch in unsicheren oder unvollständigen Situationen fundierte Entscheidungen zu treffen. Während KI große Datenmengen analysiert, um Muster zu erkennen, können Menschen durch Intuition und Erfahrung effizient handeln, selbst wenn Informationen begrenzt sind.
Im Gegensatz dazu beruht künstliche Intelligenz auf mathematischen Algorithmen und Datenmodellen, die auf Maschinenhardware laufen. Sie übertrifft den Menschen in Geschwindigkeit, Präzision und der Verarbeitung großer Datenmengen. KI kann hochkomplexe Zusammenhänge in Daten erkennen, die für Menschen unsichtbar sind, und simultan auf vielen Ebenen arbeiten und Inhalte generieren. Dennoch fehlt es ihr an echter Kreativität, Bewusstsein und der Fähigkeit, aus dem Kontext heraus gänzlich neue Konzepte zu entwickeln. Während Menschen durch Erfahrung und Intuition flexibel handeln, ist KI in der Regel auf spezifische Aufgaben beschränkt und besitzt kein eigenes Verständnis oder Bewusstsein. Sie wirkt kreativ, ist es jedoch nicht im eigentlichen Sinne!
Die Idee der „Hybrid-Intelligenz“
Eine zunehmend diskutierte Herangehensweise, um die Stärken von Mensch und KI sinnvoll zu kombinieren, ist das Konzept der Hybrid-Intelligenz [12]. Hierbei geht es um ein enges Zusammenspiel menschlicher und maschineller Fähigkeiten, in dem beide Seiten nicht nur einfache Aufgaben voneinander übernehmen, sondern sich wechselseitig ergänzen. So übernimmt die KI beispielsweise datenintensive, repetitive oder auf statistischen Mustern basierende Aufgaben, während sich der Mensch kreativen, strategischen, wertschöpfenden und empathischen Dimensionen widmet.
Ziel ist es, dass sowohl Mensch als auch Maschine ihre jeweiligen Stärken ausspielen. Menschen behalten in diesem Ansatz die Hoheit über Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse, während die KI unterstützend, beschleunigend und erweiternd wirkt. So soll die Technologie den Menschen nicht ersetzen, sondern ihm Freiräume schaffen, um sein kreatives und kritisches Potenzial zu entfalten. Auf diese Weise kann ein intelligenteres Ganzes entstehen, als beide Seiten allein je erreichen könnten.
Das Konzept der Hybrid-Intelligenz zielt darauf ab, die jeweiligen Stärken zu bündeln: Die KI stellt strukturierte Informationen bereit, führt Analysen durch, verarbeitet große Datenmengen und bietet Prognosen an. Der Mensch hinterfragt diese Ergebnisse kritisch, setzt sie in einen Kontext und entwickelt kreative Lösungsansätze. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit im kollektiven Austausch eine höhere Qualität von Entscheidungen, da jeder Akteur – Mensch oder Maschine – genau die Aspekte einbringt, in denen er besonders leistungsfähig ist. [12]
7. Kollektive Intelligenz auf einem neuen Niveau
Die Symbiose von menschlicher und künstlicher Intelligenz hebt das Prinzip kollektiver Intelligenz auf eine neue Ebene. Während jede Person individuelle Fähigkeiten und Wissen einbringt, unterstützt die KI das gesamte System in Echtzeit, indem sie Wissenslücken aufdeckt und neue Kooperationsmöglichkeiten aufzeigt. In diesem Verständnis ist jeder Mensch zugleich Datenspeicher, Erfahrungsträger, kreativer Impulsgeber und Gestalter. Entscheidungen bleiben ein interaktiver Prozess, in dem menschliche Urteilskraft, ethische Überlegungen und wirtschaftliche Aspekte eine zentrale Rolle spielen.
Ein methodischer Stolperstein aktueller KI-Ansätze besteht darin, dass sie häufig darauf ausgelegt sind, den Menschen zu ersetzen, anstatt ihn zu integrieren und intelligent zu vernetzen. Es mangelt an Architekturmodellen, die explizit auf die Kooperation zwischen Mensch und KI ausgelegt sind. Eine echte Symbiose könnte jedoch die Art und Weise, wie Menschen lernen, arbeiten und Probleme lösen, grundlegend verändern und das sogenannte Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie überwinden, indem sie die Stärken von Mensch und Maschine kombiniert.
8. Human-in-the-Loop und neuro-symbolische Ansätze
Ein zentrales Prinzip der Hybrid-Intelligenz ist die Einbindung des Menschen in den KI-gestützten Entscheidungsprozess (Human-in-the-Loop) [11]. Dabei bleibt der Mensch für qualitative Urteile, ethische Abwägungen und kreative Problemlösungen verantwortlich, während die KI datengetriebene Analysen und Vorschläge liefert. Diese Kombination ermöglicht mehr Transparenz und Kontrolle, da der Mensch direkt eingreifen und Korrekturen vornehmen kann.
Ein technologisches Kernelement der Hybrid-Intelligenz sind neuro-symbolische Ansätze, welche neuronale Netze (Deep Learning) mit symbolischer KI (Wissensgraphen, regelbasierte Systeme) kombinieren. Während neuronale Netze für ihre Fähigkeit zur Mustererkennung geschätzt werden, bieten symbolische Systeme eine bessere Erklärbarkeit. Diese Verbindung ermöglicht eine effiziente Generalisierung von Wissen, die Integration domänenspezifischer Regeln und eine transparente Interaktion mit Menschen.
Die Entwicklung hybrider Systeme ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Eine der größten technologischen Hürden ist die Qualität der Daten, auf denen KI-Modelle basieren. Ebenso erfordert die Echtzeit-Kollaboration zwischen Mensch und Maschine effiziente Synchronisationsmechanismen, um Fehlkommunikationen zu vermeiden.
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Entwicklung von Algorithmen, die kontinuierliches Lernen und dynamische Anpassung ermöglichen. Sie sollten in der Lage sein, menschliches Feedback in Echtzeit zu verarbeiten und ihre Leistung anzupassen. Gleichzeitig müssen ethische Rahmenwerke integriert werden, um sicherzustellen, dass die Systeme nicht nur effizient, sondern auch vertrauenswürdig und moralisch vertretbar sind.
Darüber hinaus sind menschenzentrierte Benutzeroberflächen notwendig, die eine intuitive und transparente Interaktion zwischen Mensch und KI erlauben. Nur durch eine nutzerfreundliche Gestaltung kann eine fortlaufende Kollaboration entstehen, in der Mensch und Maschine gegenseitig voneinander lernen.
9. Die Idee einer Hybrid-HCAI – Ein Gedankenexperiment
Während subsymbolische KI Geschwindigkeit, statistische Mustererkennung, Skalierbarkeit und Konsistenz bietet, bringt menschliche Intelligenz Kognition, Bewusstsein, Bedeutungstiefe, Empathie, moralische Verantwortung und echte Kreativität ein. Am wirkungsvollsten sind daher beide Systeme komplementär: KI skaliert Routine- und datenlastige Prozesse, während Menschen Sinn, Kontext und Verantwortung beisteuern. Das Ziel sollte darin bestehen, eine Symbiose zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz zu ermöglichen, bei der die Stärken des einen die Schwächen des anderen ausgleichen und somit die notwendigen Voraussetzungen für eine echte AGI schaffen.
Um diese ultimative Symbiose herzustellen, sind aus meiner Sicht symbolische Methoden erforderlich, also klassische wissensbasierte KI in Form von Logik, Regeln, Kausalität und Ontologien. Diese ermöglichen in Form einer neuro-symbolischen KI [13] (Hybrid-AI) die Integration menschlicher Intelligenz als dritte Komponente. Dies würde zu einer sogenannten „Trihybrid AI“ führen, die symbolische, subsymbolische und menschliche Intelligenz kombiniert. Zum besseren Verständnis würde ich diesen „Trihybriden KI-Ansatz“ jedoch „Hybrid-HCAI“ nennen, da er den Menschen auf direkte Weise einbezieht und sich an dessen Bedürfnissen ausrichtet.
Entscheidend ist, dass die symbolische KI eine vermittelnde und regulierende Rolle zwischen subsymbolischer KI und menschlicher Intelligenz übernimmt. Die eigentliche kognitive Leistung bliebe jedoch bei den beteiligten Menschen. Der Algorithmus der symbolischen KI würde auf Meta-Ebene als eine Art Selbststeuermechanismus wirken und sicherstellen, dass Informations-, Kommunikations- und Interaktionsprozesse zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen den Menschen untereinander effizient, transparent, fair und ethisch vertretbar ablaufen.
Symbolische KI wäre dabei nicht nur ein übergeordnetes Regelwerk, sondern auch eine Brücke, die das Verständnis, die Erklärbarkeit und die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen gewährleistet. In einer solchen hybriden Architektur wäre sie ein essenzieller Bestandteil, um die Stärken subsymbolischer Ansätze und menschlicher Intelligenz optimal zu kombinieren.
Mit anderen Worten: Nur die Zusammenführung von subsymbolischer und menschlicher Intelligenz mittels eines übergeordneten Regelwerks symbolischer KI kann dazu beitragen, produktive Wertschöpfung mit wirtschaftlich sinnvollem Aufwand zu erreichen und zugleich den ethischen Anforderungen einer Human-Centered AI (HCAI) [14] gerecht zu werden.
Ein solches übergeordnetes Regelwerk sollte aus technischer Prüfung, emotionaler, intrinsischer und ökonomischer Anreizstruktur sowie dezentraler Kontrolle bestehen und im Code einer neuro-symbolischen KI-Architektur fest verankert sein, um diese faktisch unveränderlich zu machen.
Ein Hybrid-HCAI-System auf Basis einer Trihybrid-Architektur integriert subsymbolische KI (lernende Systeme, Mustererkennung), symbolische Steuerung (regelbasiert, erklärbar, kontrollierbar) und menschliche Intelligenz (Urteilsvermögen, Werte, Emotionen, Feedback) zu einem Gesamtsystem. Das Regelwerk dient im übertragenen Sinne als „soziales Betriebssystem“ für Interaktion, Kontrolle und partizipative Mitgestaltung zwischen Mensch und Maschine, aber auch zwischen Menschen untereinander.
Damit stellt sich die zweite Kernfrage:
Welcher Methoden- und Architekturansatz, welches neuro-symbolisches Regelwerk (Algorithmus) und welche Mensch-Maschinenschnittstelle (User-Interfaces) erzwingt einen transparenten, fairen und ethisch vertretbaren Input-/Output-Prozess zur Wissensteilung bzw. einer Honorierung der erbrachten kognitiven Leistung des Nutzers?
10. Ein neuro-symbolisches Regelwerk zur ultimativen Symbiose
Die ideale Symbiose zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz lässt sich nur durch ein menschenzentriertes Regelwerk realisieren, das die jeweiligen Stärken gezielt kombiniert und die Schwächen kompensiert. Ein solches Regelwerk muss daher die Interaktion zwischen den Akteuren so gestalten, dass Missverständnisse, opportunistische Verzerrungen, bürokratische Hürden und vor allem unfaire Wissensteilung vermieden werden.
Das zentrale Problem besteht darin, die Anforderungen hinsichtlich Erklärbarkeit und Transparenz, adaptives Lernen und Feedbackschleifen, ethische und soziale Verantwortung sowie intuitive Schnittstellen in ein kohärentes, skalierbares und praxistaugliches Regelwerk zu überführen.
Unterschiede zwischen symbolischer, sub-symbolischer und neuro-symbolischer KI
Die symbolische KI basiert auf expliziten, regelbasierten Systemen. Hier werden Fakten, Regeln und Logiken in einer klaren, oft formalen Sprache wie Prädikatenlogik oder Ontologien abgebildet. Diese Form ist sehr erklärbar, da die Entscheidungswege meist transparent und nachvollziehbar sind. Jedoch ist symbolische KI häufig schwierig anzupassen und benötigt viel manuelle Pflege.
Demgegenüber steht die subsymbolische KI, deren Herzstück neuronale Netze und andere statistische Lernverfahren sind. Diese Form lernt implizit aus Daten, speichert Wissen in Gewichten, Vektoren oder Matrizen und kann so äußerst komplexe Muster erkennen. Allerdings erschwert ihre interne Struktur oft die Erklärbarkeit („Black Box“-Phänomen).
Die neuro-symbolische KI (Hybrid-AI) versucht, die Vorteile beider Welten zu vereinen. Durch die Verbindung von logischer Repräsentation und Mustererkennung soll die KI sowohl lernfähig bleiben als auch erklärbar sein. Das zentrale Problem hier ist die Entwicklung einer einheitlichen Wissensrepräsentation, die sowohl Symbolik als auch subsymbolische Aspekte nutzbar macht.
Ungelöste Probleme bei der Entwicklung neuro-symbolischer KI
Um symbolische und subsymbolische Ansätze erfolgreich zusammenzuführen, müssen mehrere Hürden genommen werden. Besonders herausfordernd sind folgende Punkte:
- Wissensrepräsentation: Logische Regeln müssen in einer Form vorliegen, die sich mit neuronalen Gewichtsrepräsentationen verknüpfen lässt. Dies erfordert neuartige Modelle, die symbolische Informationen für neuronale Netze verständlich machen.
- Logisches Schlussfolgern versus Mustererkennung: Symbolische KI arbeitet deterministisch mit formalen Regeln, während subsymbolische KI eher probabilistisch und datengetrieben vorgeht. Diese unterschiedlichen Paradigmen nahtlos zu vereinen, ist technisch und konzeptionell anspruchsvoll.
- Erklärbarkeit: Während symbolische Systeme für hohe Transparenz sorgen, gelten neuronale Netze als schwer verständlich. Daher müssen Mechanismen gefunden werden, die das Schlussfolgerungsverhalten eines hybriden Systems nachvollziehbar machen.
- Effizientes Lernen und Skalierbarkeit: Symbolische KI ist rechenintensiv, sobald umfangreiche Regelmengen anfallen. Neuronale Netze benötigen oft große Datenmengen. Eine hybride Lösung darf keine unpraktikablen Anforderungen stellen – weder an Rechenzeit noch an Datenvolumen.
- Modellierung von Motivation, Intention und Bewusstsein: Diese Dimensionen menschlicher Intelligenz sind bislang in keiner KI überzeugend modelliert – weder symbolisch noch subsymbolisch.
‚
Die Rolle menschlicher Intelligenz: Trihybrid Intelligenz
Angesichts dieser Herausforderungen wurde die Idee einer Trihybrid-Intelligenz formuliert, bei der zusätzlich menschliche Intelligenz integriert wird. Menschen besitzen kognitive Fähigkeiten, die KI-Systeme bislang nur unzureichend nachahmen können, darunter Intuition, Kreativität, ethische Reflektion und die Fähigkeit zum Few-Shot-Learning. Eine solche Trihybrid-Intelligenz würde symbolische, subsymbolische und menschliche Intelligenz in einem Hybrid-HCAI-Gesamtsystem vereinen.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Erhöhte Erklärbarkeit: Menschen können die „Black Box“ der KI hinterfragen und in klaren Begriffen erläutern, woher bestimmte Entscheidungen kommen.
- Kreativität und Flexibilität: Menschliche Intelligenz kann neue Lösungswege finden, die Regeln oder neuronale Netze nicht voraussehen konnten.
- Ethische Kontrolle: Menschen können den moralischen Rahmen vorgeben und auf unvorhergesehene Konsequenzen reagieren.
‚
Allerdings stellt sich die Frage, wie eine entsprechende Mensch-KI-Schnittstelle effizient und skalierbar gestaltet werden kann, ohne die Leistung des Systems zu beeinträchtigen.
Kernproblem einer Trihybrid Intelligenz
Das Kernproblem einer Trihybrid-Intelligenz besteht darin, drei sehr unterschiedliche Formen von Wissen und Entscheidungsfindung zu verbinden. Symbolische Logik, neuronale Mustererkennung und menschliche Kognition folgen je eigenen Regeln und Repräsentationsformen. Eine zentrale Architektur, die all das vereint, muss:
- Wissensformen vereinheitlichen, ohne wichtige Informationen zu verlieren.
- Flexible Lern- und Schlussfolgerungsverfahren bereitstellen, die sowohl deterministisch als auch probabilistisch arbeiten können.
- Interaktive Mensch-KI-Schnittstellen ermöglichen, bei denen menschliches Feedback kontinuierlich und effizient genutzt wird.
‚
Ein zentrales Problem ist dabei die gemeinsame Wissensrepräsentation, da Menschen mit Sprache und Intuition arbeiten, während Maschinen auf numerischen Berechnungen basieren. Eine mögliche Lösung besteht in Graphen-basierten Modellen, die strukturierte und unstrukturierte Daten zusammenführen.
Nutzer-Motivation und natürliche Selbststeuermechanismen
Um eine echte Trihybrid-Intelligenz zu entwickeln, braucht es:
- Eine universelle Wissensrepräsentation (symbolisch & subsymbolisch zugleich).
- Ein adaptives Steuerungssystem, das je nach Problemtyp zwischen Regeln, Wahrscheinlichkeiten und Intuition wechselt.
- Effiziente und skalierbare Algorithmen, die große Wissensmengen sinnvoll verarbeiten.
- Vertrauenswürdige und erklärbare Entscheidungen, die Menschen nachvollziehen können.
- Mensch-KI-Kooperation, die Stärken von Menschen nutzt, ohne deren Schwächen zu übernehmen.
‚
Die Lösung könnte in einem selbstlernenden, interaktiven System liegen, das logische Struktur, neuronales Lernen und menschliche Erfahrung dynamisch kombiniert. Doch bevor eine solche Technologie Realität werden kann, müssen fundamentale Herausforderungen gemeistert werden.
Damit stellt sich die dritte Kernfrage:
Wie kann die Motivation der Nutzer gewährleistet werden, um aktiv an einem Hybrid-HCAI-System mitzuwirken und ihre kognitive Expertise einzubringen?
Um diese Motivation zu verstehen, müssen sowohl technische als auch psychologische Faktoren berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung evolutionärer Verhaltensmuster spielt aus meiner Sicht dabei eine zentrale Rolle.
Natürliche Selbststeuermechanismen und neuro-symbolisches Regelwerk
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass evolutionär verankerte Verhaltensmechanismen – etwa Reziprozität, Fairness oder Gruppenbildung – eine entscheidende Rolle bei der Motivation in sozialen Systemen spielen. In einem Hybrid-HCAI-System sollten diese Prinzipien berücksichtigt werden.
Nur wenn diese menschenzentrierte Grundlage geschaffen ist, kann die Hybrid-HCAI ihr Potenzial vollständig entfalten und als verlässlicher Partner des Menschen agieren, anstatt an Komplexität, Intransparenz oder Kommunikationsproblemen zu scheitern.
Um Antworten auf dieses Problem zu finden, stellt sich für mich die Frage: Welche Regeln bzw. welche Selbststeuermechanismen nutzen zum Beispiel natürliche Systeme?
- Mit welchen biologischen Selbststeuerungsmechanismen bzw. Regeln der neuronalen Selbstorganisation erfolgt die Vernetzung im menschlichen Gehirn?
- Mit welchen soziologischen Selbststeuermechanismen bzw. Regeln der sozialen Selbstorganisation erfolgt die Vernetzung in einem sozialen System?
- Welche Parallelen gibt es aus biologischer und soziologischer Hinsicht und welche Faktoren beeinflussen die selbstorganisierte Vernetzung in beiden Systemen?
‚
Die Selbststeuerungsmechanismen biologischer und soziologischer Systeme zeigen bemerkenswerte Parallelen, obwohl sie auf unterschiedlichen Ebenen agieren – im Gehirn auf der Ebene von Neuronen und in sozialen Systemen auf der Ebene von Menschen. Beide Systeme basieren auf Informations-, Kommunikations- und Interaktionsprozessen, die es ihnen ermöglichen, sich dynamisch an Veränderungen anzupassen und komplexe Netzwerke zu bilden.
Im Gehirn erfolgt die Kommunikation über synaptische Verbindungen, wobei elektrische und chemische Signale weitergeleitet werden. Durch synaptische Plastizität passen sich diese Verbindungen kontinuierlich an neue Erfahrungen an – Neuronen, die wiederholt gemeinsam aktiv sind, verstärken ihre Verbindung. Ähnlich agieren soziale Systeme, in denen Menschen über Sprache, Symbole, digitale Medien und soziale Interaktionen kommunizieren.
Kommunikationsmuster verändern sich dabei im Laufe der Zeit durch gesellschaftliche Entwicklungen, technologische Innovationen und gemeinsame Erfahrungen. In beiden Fällen ist die Kommunikation zentral, um Informationen zu verknüpfen, Wissen zu generieren und gemeinsames Handeln zu koordinieren.
Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist die Musterbildung und Emergenz. Neuronale Netzwerke entwickeln durch die Interaktion vieler Neuronen emergente Verarbeitungsmuster, die komplexe kognitive Prozesse ermöglichen. Soziale Systeme zeigen ebenfalls emergente Phänomene, wenn etwa gesellschaftliche Trends, kollektive Meinungen oder soziale Bewegungen entstehen, die nicht auf das Handeln einzelner Individuen zurückzuführen sind. In beiden Kontexten entstehen Strukturen aus dezentralen, lokalen Interaktionen, ohne dass eine zentrale Steuerinstanz den Prozess vollständig kontrolliert.
Für die Aufrechterhaltung von Stabilität und Anpassungsfähigkeit sind Feedback-Mechanismen entscheidend. Im Gehirn verstärken positive Rückkopplungen stark genutzte synaptische Verbindungen, während ungenutzte abgebaut werden. Soziale Systeme nutzen ebenfalls positive und negative Rückkopplungen: So fördern gesellschaftliche Anerkennung und Belohnungen gewünschtes Verhalten, während Normverletzungen durch Sanktionen reguliert werden. Diese Mechanismen gewährleisten in beiden Systemen, dass sich neue Muster bilden, ohne dass das Gesamtsystem destabilisiert wird.
Ein zentrales Prinzip, das sowohl in neuronalen als auch in sozialen Netzwerken wirkt, ist die Plastizität. Das Gehirn zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit, neue Verbindungen aufzubauen und bestehende anzupassen, um Lernen, Gedächtnisbildung oder die Rehabilitation nach Verletzungen zu ermöglichen. Soziale Systeme demonstrieren ähnliche Anpassungsfähigkeit, wenn sie sich auf neue technologische, politische oder kulturelle Bedingungen einstellen – etwa durch neue Organisationsstrukturen, veränderte Kommunikationsformen oder innovative soziale Praktiken.
Charakteristisch für beide Systeme ist zudem die Dezentralität der Steuerung. Das Gehirn ist kein hierarchisch gesteuertes System, sondern organisiert sich durch das Zusammenspiel vieler spezialisierter Regionen und Netzwerke. Ebenso entwickeln sich soziale Systeme wie Märkte, Open-Source-Communities oder demokratische Gesellschaften häufig ohne zentrale Steuerung, indem sich kollektive Muster durch die lokale Interaktion vieler Akteure herausbilden.
Ein weiterer verbindender Mechanismus ist die dynamische Stabilität, die in beiden Systemen notwendig ist, um zwischen Beständigkeit und Veränderung zu balancieren. Das Gehirn strebt nach Homöostase, indem es interne Gleichgewichte bewahrt, während es auf neue Reize flexibel reagiert. Soziale Systeme etablieren ebenfalls stabilisierende Normen, Regeln und Institutionen, die aber an veränderte gesellschaftliche Anforderungen angepasst werden können.
Schließlich zeigen beide Systeme Selbstreferenzialität, indem sie auf eigene Erfahrungen und interne Strukturen zurückgreifen, um neue Informationen zu interpretieren. Im Gehirn manifestiert sich dies in Prozessen wie der Mustererkennung und dem Gedächtnisabruf. In sozialen Systemen äußert sich Selbstreferenzialität beispielsweise in kollektiven Identitäten, kulturellen Narrativen oder gesellschaftlichen Diskursen, die wiederum das soziale Handeln beeinflussen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die evolutionäre Dynamik sozialer Systeme als auch die neuronale Selbstorganisation auf denselben fundamentalen Prinzipien basiert: Informationsverarbeitung, Selbstreferenzialität, Emergenz, Diversität, Selbstregulation und Kommunikationsprozesse. Diese Mechanismen sind selbstorganisierte, dynamische Prozesse, die ohne zentrale Steuerung auskommen und stattdessen auf lokalen Interaktionen und globalen Feedback-Schleifen beruhen. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sozialer Systeme hängen, ebenso wie die neuronale Plastizität, von der Vielfalt der Beteiligten, der Qualität der Kommunikation und der Balance zwischen Stabilität und Wandel ab. Die evolutionären Selbststeuermechanismen sozialer Systeme sind somit ein Ausdruck kollektiver Intelligenz, die sich aus den individuellen Handlungen und Interaktionen ihrer Mitglieder emergent entwickelt.
Fazit zur ultimativen Symbiose menschlicher und künstlicher Intelligenz
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Kombination aus symbolischer, subsymbolischer und menschlicher Intelligenz ein enormes Potenzial birgt – sei es in Form einer neuro-symbolischen KI oder gar einer Trihybrid-Intelligenz (Hybrid-HCAI).
Die größten Herausforderungen liegen in der gemeinsamen Wissensrepräsentation, in der Steuerung der Mensch-KI-Interaktion und in der Bereitstellung geeigneter Motivations- und Belohnungssysteme für die Nutzer. Letzteres ist entscheidend, damit sich Menschen nicht als Erfüllungsgehilfen eines Systems sehen, sondern direkt daran partizipieren. Hier können Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie, insbesondere aus evolutionsbiologischer Perspektive, entscheidende Impulse geben.
Damit stellt sich die vierte Kernfrage:
Lassen sich Erkenntnissen zu den Selbststeuermechanismen der evolutionären Dynamik sozialer Systeme sowie der neuronalen Selbstorganisation in ein übergeordnetes, ethisch tragbares symbolisches Regelwerk übertragen?
Wenn ja, dann könnte die Vision einer Hybrid-HCAI, die symbolische Logik, neuronales Lernen und menschliche Intelligenz nahtlos vereint, eine neue Ära der KI einläuten – eine Ära, in der KI-Systeme einerseits extrem leistungsfähig und lernwillig sind, zugleich aber auch erklärbar, ethisch reflektiert und eng auf menschliche Bedürfnisse, wie emotionaler, intrinsischer und ökonomischer Nutzen abgestimmt bleiben.
Hybrid-HCAI in Unternehmen – Ein Blick in die Zukunft
Warum Hybrid-HCAI (Trihybrid-AI) in Unternehmen?
Der digitale Wandel in Unternehmen jeder Größe und Branche erfordert intelligente Systeme, die weit über klassische Automatisierung und Standardisierung hinausgehen. Was gebraucht wird, ist eine Architektur, die sich kontinuierlich an neue Aufgaben, Rollen, Ziele und Rahmenbedingungen anpasst – ohne aufwändige Change-Management-Prozesse, ineffiziente Kampagnen oder starre Rollenkonzepte. Genau hier setzt ein Trihybrid-Ansatz für Human-Centered AI (HCAI) an. Diese Architektur kombiniert symbolisches Wissen (Regeln, Ontologien), subsymbolische Intelligenz (neuronale Netze, Mustererkennung) und menschliche Intuition (Erfahrung, Heuristik) in einem skalierbaren, lernenden Gesamtsystem.
Architektonisches Fundament: Drei Intelligenzebenen und ein orchestrierendes Steuerungssystem
Das Herzstück des Ansatzes ist eine adaptive, dreiwertige Intelligenzarchitektur:
- Die symbolische Ebene verwaltet explizites Wissen: Unternehmensrichtlinien, Compliance-Regeln, Prozessmodelle, Werteorientierungen – dargestellt in Ontologien, Graphstrukturen und Regelwerken.
- Die subsymbolische Ebene nutzt Machine Learning, Sprachmodelle, Klassifikatoren und Vektordatenbanken, um Muster, Zusammenhänge und Vorhersagen zu generieren.
- Die intuitive Ebene bezieht den Menschen direkt ein – mit heuristischen Feedbackschleifen, Werturteilen, Erfahrungswissen und dialogischen Rückmeldungen.
‚
Ein symbolisches Regelwerk entscheidet für jede Aufgabe, Interaktion oder Entscheidungssituation, welche dieser Ebenen dominiert – und koordiniert deren Zusammenspiel. Dieses adaptive Steuerungssystem ist der Schlüssel zur täglichen Anpassungsfähigkeit des Systems auf individueller Ebene.
Individualisierte digitale Arbeitsplätze – täglich neu
Herzstück der Individualisierung ist ein dynamisches, hybrides Wissensmodell für jede Person. Darin werden unter anderem aktuelle Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Kommunikationsverhalten, Lernaktivitäten und Präferenzen gespeichert und laufend aktualisiert.
Die Plattform analysiert diesen Graphen täglich oder bei Bedarf in Echtzeit, um ein genaues Bild der momentanen Situation, Ziele und Herausforderungen einer Person zu erhalten.
Auf Basis dieses Kontextes entscheidet der adaptive Controller, welche Informationen, Agentenfunktionen und Werkzeuge heute am relevantesten sind. Der digitale Arbeitsplatz wird dann automatisch entsprechend zusammengestellt. Diese dynamische Architektur macht vordefinierte Rollenbilder und Standard-Arbeitsplätze überflüssig – der Arbeitsplatz passt sich „wie ein digitaler Spiegel“ an das aktuelle Tun und Denken des jeweiligen Nutzers an.
Dialogische Intelligenz: Soll-/Ist-Abgleich als Lernmotor
Ein zentrales Prinzip der Plattform ist der dialogische Soll-/Ist-Prozess, der fortlaufend dafür sorgt, dass nicht nur der Arbeitsplatz, sondern das gesamte System lernt. Immer wenn eine Regel, ein Prozess oder eine Entscheidung nicht zu den realen Anforderungen oder Erwartungen passt, wird automatisch ein interaktiver Aushandlungsprozess angestoßen. Dieser bindet die betroffenen Stakeholder – Mitarbeitende, Führungskräfte, Kunden, Partner – in einen KI-gestützten Dialog ein.
Dabei werden aktuelle Abweichungen, Zielzustände und mögliche Alternativen transparent gemacht. Dialogagenten moderieren diese Auseinandersetzungen, erfassen Korrekturen und Rückmeldungen und überführen sie strukturiert in das organisationsweite Wissenssystem.
Dieses fungiert als simulierte Repräsentation aller Prozesse, Regeln und Verantwortlichkeiten und macht organisatorisches Lernen nachvollziehbar und rückrollbar.
Motivation und Fairness durch transparente Wirkung
Damit Menschen bereit sind, ihr Wissen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, braucht es erlebbare Wirkung und systemisch verankerte Fairness. Die Plattform fördert dies durch eine Kombination aus transparenter Rückmeldung, Reputationssystemen und partizipativer Steuerung. Wer eine Entscheidung korrigiert, eine Regel präzisiert oder ein neues Ontologie-Element einbringt, sieht unmittelbar, wie sich daraufhin Vorschläge, Agentenantworten oder Prozessentscheidungen verändern.
Reputationspunkte, Rückmeldeschleifen und Peer-Validierung sorgen dafür, dass Beiträge sichtbar, bewertbar und wirkungsvoll sind – ohne autoritäre Gatekeeper. Gleichzeitig stellen symbolische Fairness- und Compliance-Regeln sicher, dass Machtasymmetrien und Interessenskonflikte nicht zu Lasten der Mitarbeitenden oder Partner gehen. So entsteht Vertrauen in das System, das sich durch Transparenz und kontinuierlichen Diskurs legitimiert.
Wandel als permanenter Zustand: Kein klassisches Change-Management mehr
Da sich die Plattform, der Arbeitsplatz und die Entscheidungslogik täglich weiterentwickeln, wird klassisches Change-Management weitgehend überflüssig. Neue Funktionen, Prozesse oder Governance-Richtlinien werden in das System eingespielt, automatisch simuliert und über dezentrale Konsensmechanismen sukzessive ausgerollt. Veränderungen erscheinen für Nutzer nicht als Bruch, sondern als logischer nächster Schritt im Arbeitsfluss.
Zusätzliche Schulungen sind nicht nötig, weil alle Neuerungen kontextsensitiv erklärt werden: Wer eine Funktion zum ersten Mal nutzt, bekommt passende Hinweise; wer in eine neue Rolle wechselt, erhält ein situatives Onboarding. Lernen geschieht kontinuierlich durch Micro-Learnings, kontextbezogene Erklärungen und dialogische Soll-/Ist-Korrekturprozesse – direkt im Flow of Work. Auf diese Weise wird Lernen zur täglichen Routine – eingebettet, relevant und skalierbar.
Skalierbarkeit und Lerneffekt: Je mehr Nutzer, desto besser wird das System
Die Architektur ist von Grund auf für massive Skalierbarkeit und Netzwerklernen gebaut. Je mehr Menschen mit dem System interagieren:
- desto besser werden Regelwerke, Ontologien, Empfehlungen und Prozesse.
- desto vielfältiger und kontextreicher wird der Wissensgraph.
- desto schneller erkennt das System Muster, Konflikte, Potenziale und Synergien.
‚
Dies geschieht nicht durch zentralisierte Steuerung, sondern durch Swarm-Sharding-Mechanismen: Wissen und Funktionen werden als Micro-Shards verteilt und wachsen dezentral dort, wo sie gebraucht werden.
Fazit: Der Arbeitsplatz wird zum lernenden Spiegelbild des Menschen
Ein Hybrid-HCAI-System auf Trihybrid-Basis verwandelt den digitalen Arbeitsplatz von einer einheitlichen IT-Struktur in ein täglich lernendes, partizipatives und menschenzentriertes System. Jeder Arbeitsplatz ist einzigartig und reagiert in Echtzeit auf Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Feedback. Die Plattform lernt gemeinsam mit den Nutzern, passt sich ohne Kampagnen an neue Rahmenbedingungen an, sichert Fairness und Entscheidungsnachvollziehbarkeit systemisch ab – und macht dadurch nicht nur Change-Management, sondern auch klassische Schulungen weitgehend überflüssig.
Sie etabliert ein lebendiges, kollaboratives Betriebssystem für jede Art von Organisation, das technische, organisatorische und kulturelle Transformation nicht mehr plant, sondern automatisch vollzieht – gesteuert durch die Intelligenz von Regeln, Daten und Menschen gleichermaßen.
12. Nutzenpotenziale einer Hybrid-HCAI-Plattform
Transformation durch intelligente Selbstanpassung
Die Einführung einer Trihybrid-AI bzw. Hybrid-HCAI-Plattform bietet für Unternehmen jeder Größenordnung und Branche nicht nur eine technologische Weiterentwicklung, sondern einen strategischen Quantensprung in der Art, wie Arbeit, Lernen, Führung und Wandel organisiert werden. Die Plattform verbindet symbolisches Wissen (Regeln, Richtlinien), subsymbolische KI (z.B. Sprachmodelle, neuronale Netze) und menschliche Intuition (Heuristiken, Werte, Erfahrung) in einem adaptiven, skalierbaren und menschenzentrierten System.
Im Folgenden werden die zentralen Nutzenpotenziale in fünf Wirkungsebenen dargestellt: Produktivität, Agilität, Innovationsfähigkeit, strukturelle Stabilität und kulturelle Integrität.
Gesteigerte Produktivität durch intelligente Individualisierung
Einer der sichtbarsten Effekte einer Hybrid-HCAI-Plattform ist die signifikante Steigerung der individuellen und kollektiven Produktivität. Der digitale Arbeitsplatz passt sich täglich an die aktuellen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und den Kontext jedes einzelnen Mitarbeitenden an. Anstatt sich durch irrelevante Informationen, überladene Dashboards oder starre Tools zu arbeiten, erhalten die Nutzer genau die Funktionen, Daten und Interaktionsmöglichkeiten, die sie an diesem Tag benötigen.
Zudem reduziert sich der nicht-wertschöpfende Organisations- und Kommunikationsaufwand der Mitarbeiter und Führungskräfte drastisch, da Entscheidungen datenbasiert, dialogisch und transparent vorbereitet und getroffen werden. Routineaufgaben, Informationssuche, manuelle Dokumentationen oder Rückfragen entfallen oder werden intelligent unterstützt. Die Folge: mehr Zeit für echte Wertschöpfung, Kreativität und menschliche Interaktion.
Höchste Agilität durch selbststeuernden Wandel
Traditionelles Change-Management mit Kampagnen, Schulungen und zentralen Roll-outs ist in dynamischen Märkten zunehmend unpraktikabel. Eine Hybrid-HCAI-Plattform überwindet diese Limitierungen, indem sie Wandel als kontinuierlichen, systeminternen Prozess etabliert.
Prozesse, Regeln und Organisationsmodelle werden als digitale Artefakte (z.B. Policies, Workflows, Entscheidungslogiken) versioniert verwaltet. Änderungen werden als Pull-Requests eingebracht, simuliert, überprüft und schrittweise ausgerollt – ohne die Notwendigkeit aufwändiger Kommunikationsmaßnahmen. Das adaptive Steuerungssystem sorgt dafür, dass sich Rollen, Dashboards und Aufgabenstrukturen bei Bedarf automatisch anpassen.
Der große Vorteil: Die Organisation wird in die Lage versetzt, sich in Echtzeit an Marktveränderungen, neue Technologien, Regulierungen oder interne Entwicklungen anzupassen – ohne dabei die operative Stabilität zu gefährden.
Nachhaltige Innovationsfähigkeit durch integrierte Kollektivintelligenz
Innovation ist in vielen Unternehmen entweder auf einzelne Innovationsabteilungen beschränkt oder auf zufällige Ideenfindung angewiesen. Die Hybrid-HCAI-Plattform bricht diese Engpässe auf, indem sie die kollektive Intelligenz der gesamten Organisation nutzbar macht.
Vorschläge, Ideen, Korrekturen und Erfahrungswissen aus der Belegschaft werden automatisch in das hybride Wissenssystem integriert, dort bewertet, visualisiert und auf ihre Wirkung hin simuliert. Entscheidungen über neue Produktideen, Prozessinnovationen oder Governance-Veränderungen können faktenbasiert und dialogisch getroffen werden. Zudem wird das Innovationslernen durch Rückkopplung mit realen Nutzungsdaten beschleunigt.
Durch die Integration externer Stakeholder – wie Kunden, Lieferanten oder Partner – in diese Dialogräume wird Innovation nicht nur vielfältiger, sondern auch marktnäher, inklusiver und nachhaltiger.
Strukturelle Stabilität durch systemische Transparenz und Selbstregulation
Komplexe Organisationen benötigen Strukturen, die zugleich belastbar und flexibel sind. Die Hybrid-HCAI-Plattform bietet genau diese Grundlage. Sie bildet alle relevanten Strukturen – Prozesse, Rollen, Regeln, Verantwortlichkeiten, Governance-Metriken – in einer versionierten, simulierbaren und nachvollziehbaren Form digital ab.
So entsteht ein kontinuierlich aktualisierter Echtzeit-Zwilling der Organisation, der Veränderungen testbar macht, Schwachstellen frühzeitig erkennt und die Basis für automatische Governance-Checks bildet. Frühwarnsysteme, Abweichungsanalysen und systemische Zielkonflikt-Detektion ermöglichen ein präventives Management anstelle reaktiver Krisenintervention.
Diese strukturierte Selbstregulation macht die Organisation resilient gegenüber externen Schocks und internen Spannungen – bei gleichzeitiger Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen.
Kulturelle Stabilität durch Fairness, Transparenz und Partizipation
Neben technologischen und organisatorischen Effekten stärkt eine Hybrid-HCAI-Plattform auch die kulturelle Integrität eines Unternehmens. Entscheidungsprozesse werden erklärbar, begründbar und nachvollziehbar – nicht nur für Führungskräfte, sondern für alle Beteiligten. Empfehlungen der KI werden mit den Unternehmenswerten abgeglichen, und systematische Fairnessmechanismen verhindern Diskriminierung oder Intransparenz.
Wissenserhebung und -bewertung erfolgen partizipativ: Mitarbeitende können direkt erleben, wie ihr Beitrag das System verändert, verbessert oder neue Perspektiven ermöglicht. Reputation, Sichtbarkeit und Wirkung sind klar mess- und erlebbar. So entsteht ein gerechtes, wertschätzendes und kooperatives Arbeitsumfeld, das Vielfalt fördert, Engagement stärkt und eine gerechte Honorierung der kognitiven Leistung ermöglicht.
Insbesondere in verteilten, hybriden und interkulturellen Umgebungen ist dies ein entscheidender Faktor für Zusammenhalt, Vertrauen und Identifikation.
Grundsatzfragen für Unternehmen
Für Unternehmen ergeben sich aus meiner Sicht folgende fünf Grundsatzfragen:
- Welche Informations-, Kommunikations- und Interaktionsprozesse sollte eine Hybrid-HCAI unterstützen, um in einem Unternehmen Produktivität, Agilität und Innovationsfähigkeit zu steigern sowie strukturelle und kulturelle Stabilität zu gewährleisten?
- Welcher Methoden- und Architekturansatz, welches neuro-symbolisches Regelwerk (Algorithmus) und welche Mensch-Maschinenschnittstelle (User-Interfaces) erzwingt einen transparenten, fairen und ethisch vertretbaren Input-/Output-Prozess zur Wissensteilung bzw. einer Honorierung der erbrachten kognitiven Leistung des Nutzers?
- Lassen sich Erkenntnisse zu den Selbststeuermechanismen der evolutionären Dynamik sozialer Systeme sowie der neuronalen Selbstorganisation in ein übergeordnetes, ethisch tragbares neuro-symbolisches Regelwerk übertragen?
- Wie implementiert man ein dezentrales, sich selbstorganisierendes System in einem zentral gesteuerten, hierarchisch strukturierten Unternehmen, das für alle Stakeholder transparent, fair und ethisch vertretbar ist?
- Wie lässt sich messen, in welchem Umfang KI-Modelle/Plattformen den Anforderungen einer Hybrid-HCAI wirklich gerecht werden, und an welchen Kennzahlen kann die produktive Wertschöpfung sowie die strukturelle und kulturelle Stabilität im Unternehmen festgemacht werden?
13. Auswirkungen einer Hybrid-HCAI auf Wirtschaft und Gesellschaft
Die Markteinführung eines Hybrid-HCAI-Systems durch beispielsweise ein innovatives Startup hätte weitreichende Auswirkungen auf zahlreiche wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Bereiche. Eine solche technologische Entwicklung könnte nicht nur bestehende Geschäftsmodelle transformieren, sondern auch neue Märkte erschließen und weitreichende Veränderungen in der Art und Weise bewirken, wie Menschen und Maschinen zusammenarbeiten.
Auswirkungen auf Aktienmärkte
Die Einführung einer bahnbrechenden Hybrid-HCAI-Technologie durch ein Startup könnte unmittelbar große Aufmerksamkeit von Investoren und Risikokapitalgebern auf sich ziehen. Unternehmen, die frühzeitig auf diese Innovation setzen, könnten als Pioniere des neuen technologischen Paradigmas angesehen werden, was ihre Bewertung an den Finanzmärkten erheblich steigern könnte. Insbesondere der Technologiesektor und spezifisch KI-bezogene Aktien dürften von einem solchen Fortschritt profitieren, da Anleger verstärkt Kapital in Unternehmen investieren würden, die sich an der Spitze der KI-Entwicklung befinden.
Allerdings könnte diese Marktdynamik auch zu erhöhter Volatilität führen. Während Unternehmen, die auf Hybrid-HCAI setzen, möglicherweise von steigenden Aktienkursen profitieren, könnten Firmen, die weiterhin auf herkömmliche KI-Modelle oder traditionelle Automatisierungslösungen setzen, Marktanteile und Investitionen verlieren. Dies könnte kurzfristig zu starken Kursschwankungen führen, insbesondere bei Tech-Giganten, die sich bisher auf das Einsammeln und Vermarkten von Nutzer-Daten/Wissen mittels generativer KI oder klassische Automatisierungs-, Überwachungs- und Steuerungstechnologien konzentriert haben.
Diese etablierten Marktführer müssten sich möglicherweise schnell anpassen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dazu könnten sie entweder selbst verstärkt in Hybrid-HCAI-Forschung investieren oder strategische Übernahmen tätigen, um den technologischen Anschluss nicht zu verlieren.
Auswirkungen auf die Wirtschaft
Die Einführung von Hybrid-HCAI-Technologien hätte weitreichende wirtschaftliche Folgen, insbesondere im Bereich der Produktivität und Innovationskraft von Unternehmen. Die Kombination aus maschineller Intelligenz und menschlichem Urteilsvermögen könnte die Effizienz in zahlreichen Branchen erheblich steigern. Unternehmen, die diese Technologie nutzen, könnten zeitnah und effizient Prozesse optimieren, Entscheidungsfindungen beschleunigen und insgesamt eine höhere Wertschöpfung erzielen. Dies könnte zu einem Innovationsschub führen, da neue Geschäftsmodelle entstehen, die auf der nahtlosen Integration von menschlicher und künstlicher Intelligenz basieren.
Ein bedeutender Aspekt dieser Entwicklung wäre die Transformation von Arbeitsplätzen. Während traditionelle, stark repetitive Tätigkeiten weiterhin durch Automatisierung ersetzt werden könnten, würden gleichzeitig neue Berufsfelder entstehen. Diese neuen Arbeitsbereiche könnten sich darauf konzentrieren, kreative Problemlösungen zu entwickeln, strategische Entscheidungen zu treffen und KI-gestützte Erkenntnisse kritisch zu hinterfragen. Menschen würden zunehmend als Vermittler und Kontrollinstanz zwischen Technologie und realen Anwendungen fungieren.
Wichtig in diesem Zusammenhang wäre zu erwähnen, dass die Transformation von Arbeitsplätzen nicht fremdorganisiert durch externe Beratungsunternehmen oder KI-Technologien erfolgt, sondern die Mitarbeiter und Führungskräfte den Transformationsprozess kontinuierlich selbst gestalten.
Zudem könnten Unternehmen neue hybride Geschäftsmodelle entwickeln, die menschliche und maschinelle Intelligenz kombinieren. Beispielsweise könnten Dienstleistungen entstehen, bei denen KI hochkomplexe Datenanalysen durchführt, während Menschen die Ergebnisse interpretieren und individuelle Lösungen entwickeln.
Auswirkungen auf die Gesellschaft
Auch gesellschaftlich könnte die Einführung von Hybrid-HCAI-Technologien tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. Eine der zentralen Herausforderungen wäre die Anpassung des Bildungssystems an die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes. Da die Fähigkeit zur selbstbestimmten Zusammenarbeit mit KI immer wichtiger wird, müssten Schulen und Universitäten ihre Lehrpläne entsprechend anpassen. Neben klassischen Fachkenntnissen müssten verstärkt Kompetenzen in den Bereichen Datenanalyse, kritisches Denken und interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden.
Gleichzeitig würden mit der neuen Technologie auch ethische Fragen aufgeworfen. Es müsste sichergestellt werden, dass Hybrid-KI-Systeme fair, transparent und inklusiv gestaltet werden. Andernfalls könnten bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten weiter verstärkt werden, insbesondere wenn der Zugang zu diesen Technologien ungleich verteilt wäre oder algorithmische Entscheidungsprozesse bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch benachteiligen würden.
Ein weiterer entscheidender Punkt wäre das Vertrauen der Menschen in KI-gestützte Systeme. Da Hybrid-KI menschliche Expertise mit maschinellen Entscheidungsprozessen kombiniert, könnte dies dazu beitragen, die Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz zu verringern. Die Einbindung von menschlichen Kontrollinstanzen könnte sicherstellen, dass kritische Entscheidungen nicht ausschließlich von Algorithmen getroffen werden, sondern stets eine menschliche Bewertung erhalten. Dies könnte in nahezu allen Bereichen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft dazu führen, dass die Akzeptanz und das Vertrauen in KI-Lösungen langfristig steigen.
Fazit: Eine menschzentrierte Zukunft mit KI
Zusammenfassend bildet dieses Zusammenwirken von Mensch und Maschine eine wegweisende Perspektive für die künftige Arbeits- und Lernwelt. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die technischen Infrastrukturen nicht nur leistungsfähig, sicher und skalierbar sind, sondern auch so gestaltet werden, dass sie die menschliche Seite in den Mittelpunkt stellen: Transparenz, Nutzerfreundlichkeit, Datenschutz und eine angemessene Einbindung in die bestehenden Organisationsprozesse sind dabei grundlegende Erfolgsfaktoren. Gelingt es, diese Aspekte auszubalancieren, kann die „Trihybrid-Intelligenz“ die kollektive Intelligenz in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf ein völlig neues Niveau heben und einen innovativen, menschzentrierten Fortschritt ermöglichen.
Eine solche Symbiose könnte die Welt der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht bereichern. Zum einen würden die Analysefähigkeiten der KI die Arbeit von Forschenden, Unternehmen und Entscheidungsträgern drastisch beschleunigen. Große Datenbestände, die in traditionellen Prozessen manuell kaum zu bewältigen wären, ließen sich innerhalb kürzester Zeit sichten und auswerten. Menschen könnten darauf aufbauend grundlegende Strategien entwickeln, Hypothesen formulieren und kreative Lösungsansätze verfolgen.
Zum anderen ergibt sich durch die globale Vernetzung ein kollektives Gedächtnis, das jederzeit abrufbar ist und kontinuierlich wächst. Die individuelle Expertise jedes Menschen fließt in einen gemeinsamen Pool ein, wird entsprechend der kognitiven Leistung honoriert und wiederum allen zugänglich gemacht. Dieses Modell würde nicht nur die Kollaboration über geographische Grenzen hinweg stärken, sondern auch den Wissenstransfer drastisch beschleunigen. Neue Erkenntnisse würden sich nahezu in Echtzeit verbreiten, und vielversprechende Ideen könnten global weiterentwickelt werden, ohne an opportunistischen, bürokratischen oder sprachlichen Barrieren zu scheitern.
14. Beziehung zum Konzept der Artificial General Intelligence
Allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) bezeichnet eine bislang hypothetische Form der KI, die in der Lage ist, Wissen zu verstehen, zu lernen und flexibel auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und Problembereiche anzuwenden – in einem Maß, das der menschlichen kognitiven Leistungsfähigkeit gleichkommt oder diese übertrifft. Merkmale sind unter anderem allgemeine Problemlösefähigkeit, Lernfähigkeit über verschiedene Domänen hinweg und selbstständiges Schlussfolgern ohne spezifische Vorprogrammierung. Quelle (sinngemäß angelehnt): Goertzel, B., & Pennachin, C. (2007). Artificial General Intelligence. Springer. [15]
Das Konzept der Hybrid-HCAI könnte aus meiner Sicht eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Entwicklung einer Artificial General Intelligence (AGI) spielen. Während herkömmliche AGI-Ansätze vor allem darauf abzielen, menschenähnliche kognitive Fähigkeiten autonom zu reproduzieren, setzt die Hybrid-HCAI auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Diese Symbiose vereint menschliche Kreativität, Intuition und Kontextverständnis mit der Rechenleistung, Skalierbarkeit und Präzision künstlicher Intelligenz.
Insbesondere die neuro-symbolische KI, die datengetriebene Methoden wie Deep Learning mit symbolischen Ansätzen wie Logiksystemen und Wissensgraphen kombiniert, kann dazu beitragen, Entscheidungsprozesse nicht nur effizienter, sondern auch nachvollziehbarer und erklärbarer zu gestalten. Gleichzeitig betont die menschenzentrierte KI (HCAI), dass der Mensch als kritischer Teil der Entscheidungsfindung erhalten bleibt und somit ethische, kulturelle und soziale Werte aktiv in die Technologieentwicklung einbringt.
Die Entwicklung einer AGI auf Basis von Hybrid-HCAI orientiert sich an einem ko-evolutionären Ansatz. Anstatt eine vollständig autonome Superintelligenz zu erschaffen, die den Menschen möglicherweise überflügelt oder ersetzt, wird eine „integrierte Intelligenz“ angestrebt, in der Mensch und Maschine kontinuierlich miteinander lernen und sich weiterentwickeln.
Bereits heute lassen sich durch die Kombination neuro-symbolischer Methoden und menschlicher Expertise bestehende KI-Systeme verbessern. Gleichzeitig entsteht durch die kontinuierliche Mensch-KI-Interaktion ein Kreislauf des wechselseitigen Lernens: Menschen korrigieren die KI, was zu präziseren Modellen führt, während die KI Menschen bei der Bewältigung komplexer Probleme unterstützt. Aus dieser engen Zusammenarbeit könnte langfristig eine AGI entstehen, die nicht isoliert im Labor entwickelt wird, sondern aus einer evolutionären, praxisorientierten Symbiose hervorgeht.
Insgesamt bietet die Hybrid-HCAI bzw. menschenzentrierte Hybrid-AI einen vielversprechenden Weg zur Entwicklung einer AGI, die die Potenziale künstlicher Intelligenz mit den einzigartigen Fähigkeiten des Menschen verbindet. Sie kann nicht nur technologische Innovationen beschleunigen, sondern auch zu einer verantwortungsvollen, ethischen und gesellschaftlich akzeptierten Nutzung von KI beitragen.
Der Schlüssel zur AGI liegt somit nicht in der Schaffung einer autonomen Superintelligenz, sondern in der Ko-Evolution von Mensch und Maschine – einer Symbiose, in der beide Partner gemeinsam lernen, gestalten und wachsen. Diese Vision einer „integrierten Trihybrid-Intelligenz“ könnte der entscheidende Schritt zu einer AGI sein, die menschliche Werte, Empathie und kreatives Potenzial nicht nur honoriert und respektiert, sondern als integralen Bestandteil ihrer eigenen Intelligenz verinnerlicht.
15. Open-HCAI – Ein hypothetisches Gedankenexperiment
Unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto wurde im Oktober 2008 das Whitepaper zur Kryptowährung Bitcoin veröffentlicht und im Januar 2009 erfolgte die Referenzimplementierung der ersten Bitcoin Core Version. Die Bitcoin-Architektur basiert auf Grundregeln, die im Code fest verankert sind! Die Kombination aus technischer Prüfung, ökonomischer Anreizstruktur und dezentraler Kontrolle macht diese Regeln faktisch unveränderlich. Bitcoin 2025: 106-150 Millionen Menschen besitzen Bitcoins, Anzahl Bitcoin-Wallets ca. 200 Millionen, Marktkapitalisierung ca. 2,08 Billionen USD, tägliche Transaktionen ca. 424.769. [16]
Jetzt stellen Sie sich vor, eine Person oder eine Gruppe aus KI-Forschern, Technologen, Ethikern und ökonomischen Vordenkern veröffentlicht ein Whitepaper zu einer Open-Trihybrid-AI bzw. Open-HCAI und führt eine Referenzimplementierung durch, deren Architektur ebenfalls auf ethischen Grundregeln basiert, die im Code fest verankert sind. Die Kombination aus technischer Prüfung, emotionaler, intrinsischer und ökonomischer Anreizstruktur sowie dezentraler Kontrolle macht diese Regeln ebenfalls faktisch unveränderlich.
Ich denke, damit würde die Welt am Beginn einer neuen Ära stehen: Die Ära menschenzentrierter, frei zugänglicher künstlicher Intelligenz, in der Intelligenz nicht länger exklusiv, teuer oder schwer verständlich ist, sondern offen, intuitiv und für jeden Menschen nutzbar wäre. Es ist im Grunde die Vision einer Artificial General Intelligence (AGI): einer dezentralen, autonomen, domänenübergreifenden und menschenzentrierten KI-Plattform, die unser Verhältnis zu Wissen, Arbeit und Verantwortung neu ordnet. Die wahre Innovation liegt jedoch im ethischen Design: Technik so zu bauen, dass sie menschlich bleibt. Wenn wir das schaffen, wird Open-HCAI nicht nur eine Plattform. Sie wird ein Versprechen auf eine gerechtere Zukunft für alle.
Ein Zukunftsszenario:
Open-HCAI wird zur digitalen Infrastruktur wie Wasser oder Strom. Bildung, Innovation und Teilhabe florieren weltweit. Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit werden zur Grundlage produktiver Wertschöpfung, sozial-ökologischen und ökonomischen Wachstums sowie steigenden Wohlstands in allen Bereichen einer Gesellschaft. Menschen werden von dem Gefühl geleitet, dass sie in der Kommunikation und Interaktion mit ihrem sozialen Umfeld fair behandelt werden, bzw., dass das, was sie auf emotionaler, intrinsischer und ökonomischer Weise einbringen und das, was sie zurückbekommen, mindestens ausgeglichen ist.
Aufgrund der im Code fest verankerten sozialen Selbststeuermechanismen ist aus meiner Sicht die Manipulation durch technischen Missbrauch oder eine gezielte Umgehung des Regelwerks durch machtvolle Interessengruppen über narrative Kontrolle, Plattformdominanz oder politische Einflussnahme nahezu ausgeschlossen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bitcoin-Architektur. Wer hätte 2009 geglaubt, dass 2025 der CEO des größten Vermögensverwalters der Welt, Larry Fink, die Befürchtung äußert, dass der US-Dollar seine global führende Rolle an die Kryptowährung Bitcoin verlieren könnte (Blackrock-Chef sieht den Dollar durch Bitcoin bedroht). [17]
Damit stellt sich für mich eine fünfte „hypothetische“ Kernfrage:
Welche Auswirkungen hätte eine Zusammenführung einer Open-HCAI- und Bitcoin- Architektur?
16. Auswirkungen einer Open-HCAI für unsere Zukunft
Finanzmärkte: Der Kontrollverlust über KI-Renditen
Die traditionellen Finanzmärkte würden in ihrer Grundstruktur erschüttert. KI ist heute ein zentraler Treiber von Unternehmensbewertungen, insbesondere bei Tech-Giganten. Wenn jedoch eine hochleistungsfähige, universelle KI frei verfügbar wäre, verlören proprietäre KI-Modelle ihren Wettbewerbsvorteil. Geschäftsmodelle, die auf exklusivem Zugang zu Intelligenz beruhen, würden obsolet. Margen würden einbrechen, Investoren umdenken.
Gleichzeitig würden sich neue Möglichkeiten ergeben. Tokenisierte Governance-Systeme, wie sie aus dem Blockchain-Bereich bekannt sind, könnten neue Formen der Wertbindung schaffen – etwa durch Beteiligung an der Weiterentwicklung, Auditing oder Wartung der Plattform. Neue Finanzmärkte könnten entstehen, in denen die ethische Qualität, Transparenz oder gesellschaftliche Wirkung von Technologie eine neue Form von „Wert“ darstellt.
Doch auch makroökonomisch wären die Auswirkungen gravierend. So wie Bitcoin die globale Rolle des US-Dollars infrage stellt, könnte Open-HCAI die staatliche Kontrolle über eine strategisch zentrale Infrastruktur – Intelligenz – unterwandern.
Wirtschaft: Innovation ohne Eintrittsbarrieren
Die Wirtschaft würde einen radikalen Strukturwandel durchlaufen. Open-HCAI würde die Eintrittsbarrieren für Unternehmen, Startups und Einzelpersonen, die KI nutzen oder weiterentwickeln wollen, drastisch senken. Wo heute Cloud-Kosten, Lizenzmodelle und Zugriffsbeschränkungen dominieren, herrschte dann offene Verfügbarkeit.
Dieser Zugang hätte einen demokratisierenden Effekt auf Innovation. Jeder Mensch – unabhängig von Standort oder Kapital – könnte auf eine der mächtigsten Technologien der Welt zugreifen. Unternehmen könnten nicht mehr durch Exklusivität glänzen, sondern müssten sich über ethischen Mehrwert, Kreativität, Fairness und Nutzerorientierung differenzieren.
Gleichzeitig entstünden völlig neue Branchen: Auditing, ethisches Monitoring, menschliche Rückkopplungssysteme, partizipative Trainingsmodelle, dezentrale Entscheidungsplattformen. Die Wertschöpfung verlagert sich vom Eigentum an der KI zur Gestaltung des Zusammenspiels zwischen Mensch und Maschine.
Politik: Machtverschiebung und Governance-Neudefinition
Eine frei zugängliche, dezentral gesteuerte KI-Plattform würde die Grundannahmen politischer Kontrolle herausfordern. Staaten, die heute ihre digitale Infrastruktur zentral organisieren, sähen sich mit einer nicht kontrollierbaren, öffentlichen Superintelligenz konfrontiert. Die klassischen Werkzeuge der Regulierung – Lizenzpflichten, Kontrolle von Serverzentren, Plattformregeln – würden ins Leere laufen.
Das würde neue internationale Regelwerke erfordern, ähnlich wie es im Internetrecht, bei Open-Source-Standards oder der Klimapolitik der Fall ist. Globale Abstimmungen über ethische Richtlinien, partizipative Governance-Systeme und technologisch verankerte Kontrollmechanismen (wie bei Bitcoin) würden zur Voraussetzung für Vertrauen und Stabilität.
Zugleich verlören autoritäre Systeme einen entscheidenden Hebel: die Kontrolle über Wissen, Kommunikation und digitale Intelligenz. Insofern könnte Open-HCAI auch ein politisch-emanzipatorisches Instrument sein – eine digitale Allmende gegen Zentralismus.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass so manche Oligarchen, Autokraten und Diktatoren versuchen werden, ein solches System zu verhindern oder zu sperren, weil man es selbst nicht überwachen und steuern kann.
Gesellschaft: Kollektive Intelligenz und neue soziale Grammatik
Die gesellschaftlichen Auswirkungen wären vielleicht die tiefgreifendsten. Wenn jeder Mensch Zugang zu einer mächtigen, ethisch konzipierten KI hätte, die ihn nicht ersetzt, sondern stärkt, entstünde eine neue Form der kollektiven Intelligenz. Bildung würde nicht mehr zentral „vermittelt“, sondern individuell angeeignet – selbstgesteuert, situationsabhängig, eingebettet in echte Probleme.
Das bedeutet: Jeder Mensch hätte dieselben Chancen, sich weiterzubilden, kreative Lösungen zu finden oder an gesellschaftlicher Entwicklung teilzunehmen. Diese Chancengleichheit würde nicht nur soziale Gerechtigkeit befördern, sondern auch ökonomische Produktivität – denn Talente, die heute durch Armut, Isolation oder fehlende Infrastruktur verschwendet werden, könnten sich entfalten.
Soziale Teilhabe würde dabei nicht nur auf wirtschaftlicher, sondern auch auf emotionaler Ebene stattfinden: Menschen könnten auf Augenhöhe kommunizieren, ihre Beiträge würden anerkannt, ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Eine neue „soziale Grammatik“ der Kooperation würde entstehen – nicht auf Basis von Hierarchie, sondern durch geteilte Verantwortung und technologische Fairness.
Fazit: Eine neue Zivilisationsstufe?
Die Einführung einer frei verfügbaren, dezentralen, ethisch kodierten und menschenzentrierten KI-Plattform wäre kein gewöhnlicher Technologiesprung. Sie wäre ein zivilisatorisches Ereignis. Eine kollektive Infrastruktur für Intelligenz, getragen von vielen, gesteuert von niemandem, offen für alle.
So wie Bitcoin den Begriff von Geld revolutioniert hat und Linux die Softwarewelt dezentralisiert hat, könnte Open-HCAI unser Verhältnis zu Wissen, Arbeit und Verantwortung neu ordnen. Es wäre kein Produkt, sondern ein Versprechen: Dass Technologie uns nicht ersetzt, sondern stärkt. Dass Ethik nicht aufgesattelt, sondern eingebaut wird. Und dass menschliche Würde, Kreativität und Teilhabe keine Geschäftsmodelle sind – sondern das Fundament einer gerechten Zukunft.
Die wahre Innovation wäre nicht technischer Natur. Sie läge im Design einer Menschlichkeit, die technologisch unbestechlich bleibt.
17. Meine vorläufigen Schlussfolgerungen
Daron Acemoğlu gilt als einer der schärfsten und differenziertesten Kritiker der aktuellen Entwicklung digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz. Er sieht enormes Potenzial in der Technologie, warnt aber eindringlich vor einem falschen Weg. Aus seiner Sicht gibt es mehrere zentrale ungelöste Kernfragen und Herausforderungen, die adressiert werden müssen, damit KI und Digitalisierung einen echten ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen bringen. Diese lassen sich in folgende Hauptbereiche untergliedern:
- Wie kann KI zur Ergänzung statt zum Ersatz menschlicher Arbeit eingesetzt werden?
- Aktuelle KI-Anwendungen fokussieren sich stark auf Automatisierung – also auf den Ersatz menschlicher Tätigkeiten. Acemoglu plädiert hingegen für „complementary technologies“, die menschlichen Fähigkeiten erweitern, nicht verdrängen. [18]
- Wo entstehen durch KI tatsächlich neue, sinnvolle Aufgabenfelder für Menschen?
- Damit KI Wohlstand schafft, muss sie neue Tätigkeiten ermöglichen – ähnlich wie frühere technologische Umbrüche. Bisher bleibt unklar, welche sinnvollen neuen Jobs durch generative KI wirklich entstehen. [19]
- Warum priorisieren wir AGI-Entwicklung, obwohl keine realen Produktivitätsgewinne nachweisbar sind?
- Die enorme Investitionsdynamik rund um „künstliche allgemeine Intelligenz“ (AGI) entzieht Ressourcen für praktische, kurzfristig nützliche Anwendungen – obwohl es weder klare Erfolge noch wirtschaftliche Durchbrüche gibt. [20]
- Wie lässt sich eine KI-Entwicklung gestalten, die breitere Teilhabe an den Wertschöfungsgewinnen ermöglicht?
- Aktuell profitieren vor allem große Tech-Konzerne von KI. Es fehlen Modelle, bei denen auch Arbeitnehmer, kreative Urheber oder die Gesellschaft an den Erträgen beteiligt werden. [21]
- Wie können wir Geschäftsmodelle ändern, die auf Datenextraktion und Überwachung beruhen?
- Viele KI-Anbieter monetarisieren Nutzerverhalten durch Werbung, Profiling oder Überwachung. Diese Geschäftsmodelle fördern keine sinnvolle Produktivität, sondern erzeugen soziale und politische Risiken. [22]
- Wann werden die massiven Investitionen in KI tatsächlich wirtschaftlich produktiv?
- Milliardenausgaben fließen in KI-Startups, Chips und Cloud-Infrastruktur – doch konkrete Nutzenmessung und reale Produktivitätszuwächse fehlen bisher weitgehend. [23]
- Wie können demokratische und ethische Prinzipien in die technologische Architektur integriert werden?
- Viele KI-Systeme sind intransparent („Black Boxes“) und können zu unfairen Entscheidungen führen. Es sind transparente Algorithmen und erklärbare KI-Modelle („Explainable AI“) und Open-Source-Architekturen erforderlich. [24]
- Welche neuen Kennzahlen brauchen wir, um den sozialen Nutzen von KI zu messen?
- Acemoglu fordert Maßstäbe wie den Arbeitsanteil an der Wertschöpfung oder neue Produktivitätsmetriken, die nicht nur Effizienz, sondern auch Verteilungsgerechtigkeit abbilden. [25]
‚
Gary Marcus schreibt in seinem Beitrag „A knockout blow for LLMs“ vom 8. Juni 2025:
„Wann immer mich Leute fragen, warum ich (entgegen dem weit verbreiteten Mythos) KI eigentlich mag und denke, dass KI (wenn auch nicht GenAI) letztendlich von großem Nutzen für die Menschheit sein könnte, verweise ich immer auf die Fortschritte in Wissenschaft und Technologie, die wir machen könnten, wenn wir die kausalen Denkfähigkeiten unserer besten Wissenschaftler mit der schieren Rechenleistung moderner digitaler Computer kombinieren könnten.“ [9]
Diesem Statement von Gary Marcus möchte ich ausdrücklich folgen und auf die ungelösten Kernfragen und Herausforderungen einer AGI beziehungsweise Hybrid-AI verweisen, die Gary Marcus in verschiedenen Beiträgen und Publikationen sehr treffend beschrieben hat.
Diese Kernfragen habe ich wie folgt zusammengefasst:
- Wie integriert man symbolische und sub-symbolische Komponenten nahtlos?
- Es fehlt an Architekturmodellen, die symbolisches Denken flexibel mit neuronaler Repräsentation kombinieren. [26] [27]
- Wie kann ein System Konzepte abstrahieren und auf neue Situationen übertragen?
- Generalisierung jenseits des Trainingsdatensatzes ist schwach – symbolische Komponenten könnten das Verbessern, aber Integration ist schwierig. [28]
- Wie erlangt ein System echtes kausales Verständnis?
- LLMs operieren meist auf rein statistischer Korrelation. AGI muss Ursache-Wirkungs-Beziehungen verstehen und begründen können. [29]
- Wie lernt ein System kontinuierlich und kumulativ („Lifelong Learning“)?
- Aktuelle Systeme vergessen frühere Informationen („catastrophic forgetting“) oder lernen nicht inkrementell. AGI muss nachhaltig lernen können. [30]
- Wie wird abstraktes, systematisches Denken erreicht?
- Logik, Algebra, Grammatik – menschliche Intelligenz kann systematische Regeln flexibel anwenden. KI muss das ebenfalls beherrschen. [31]
- Wie modelliert man Motivation, Intention und Bewusstsein?
- Diese Dimensionen menschlicher Intelligenz sind bislang in keiner KI überzeugend modelliert – weder symbolisch noch sub-symbolisch. [32]
- Wie kann man Vertrauen, Verifikation und Transparenz schaffen?
- Ein AGI-System muss überprüfbar, korrigierbar und erklärbar sein. Symbolische Komponenten könnten hier helfen – aber es fehlt an konkreten Umsetzungen. [33]
‚
Um Antworten auf diese Fragen zu finden schreibt Gary Marcus in seinem Beitrag Deep learning is hitting a wall: „Bei all den Herausforderungen in den Bereichen Ethik und Informatik und dem Wissen, das aus Bereichen wie Linguistik, Psychologie, Anthropologie und Neurowissenschaften und nicht nur aus Mathematik und Informatik benötigt wird, wird es ein ganzes Dorf brauchen, um zu einer KI aufzuwachsen.“ [34]
Diese Aussage von Gary Marcus möchte ich jedoch ergänzen: Es bedarf nicht nur eines interdisziplinären Teams von Wissenschaftlern, sondern darüber hinaus einer interdisziplinären Idee, die eine gemeinsame Sicht und ein gemeinsames Verständnis einer ganzheitlichen Hybrid-HCAI-Lösung ermöglicht. Mit anderen Worten: Die Idee eines integrativen Ansatzes von Methode und Technologie, in dem sich jede Fachdisziplin mit ihrer Perspektive wiederfindet und gleichzeitig alle Perspektiven zusammenführt und für jeden nachvollziehbar macht.
Darüber hinaus müssten sich alle Beteiligten einig darüber werden, auf Grundlage welcher Geschäftsmodellvariante sie die Entwicklung einer Hybrid-HCAI, Open-HCAI oder AGI vorantreiben wollen, sodass jeder auch einen persönlichen Nutzen daraus ziehen kann.
Drei Geschäftsmodellvarianten zur Umsetzung
Angenommen, Sie hätten selbst schlüssige, nachvollziehbare Antworten beziehungsweise umsetzbare Lösungsansätze zu diesen Fragen und Herausforderungen. Für welche der nachfolgenden drei Geschäftsmodellvarianten würden Sie sich entscheiden, um diese umzusetzen:
Variante A: Ein Startup gründet, um eine marktfähige Hybrid-HCAI-Anwendung zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, und bei einem entsprechenden Angebot eines der Big-Tech-Unternehmen das Startup verkaufen?
Variante B: Die Antworten bzw. Lösungsansätze einer Open-HCAI in einem Buch oder Whitepaper veröffentlichen und gemeinsam mit einer anonymen Entwicklergruppe eine entsprechende AGI-Plattform kostenlos ins Netz stellen?
Variante C: Ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen gründen, um eine marktfähige Hybrid-HCAI/Open-HCAI zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das nach innen wie nach außen nach den gleichen Prinzipien arbeitet und die Vorteile der Variante A mit den Vorteilen der Variante B kombiniert sowie deren Nachteile kompensiert?
Fazit
Gerade Investoren sollten sich genau überlegen, in welche KI-Modelle, KI-Infrastrukturen und KI-Unternehmen sie heute und in Zukunft investieren. Denn wenn Hybrid-HCAI oder gar Open-HCAI erst einmal Realität sind, lassen sie sich meiner Ansicht nach nicht mehr aufhalten, und bisherige Investitionen könnten sich sehr schnell in Luft auflösen.
Ebenso glaube ich, dass Unternehmen und sonstige Organisationen den Fokus darauf legen sollten, sich mit Methoden und Architekturansätzen sowie KI-Modellen auseinanderzusetzen, die mittels individualisierter digitaler Arbeitsplätze den nicht-wertschöpfenden Organisations- und Kommunikationsaufwand ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte wirklich senken. Unternehmen brauchen einen Paradigmenwechsel in ihrer KI-Strategie, weg vom Paradigma der fremdorganisierten Automatisierung, Überwachung und Steuerung, hin zur intelligenten, selbstorganisierten Vernetzung menschlicher Fähigkeiten.
Ich bin davon überzeugt, dass nicht die großen Tech-Konzerne und Plattformanbieter, sondern die Menschen, Unternehmen und sonstigen Organisationen, die wirkliche Wertschöpfung erbringen, die Hauptprofiteure von künstlicher Intelligenz sein sollten!
18. Mein Statement
Die in diesem Essay skizzierte Vision einer Hybrid-HCAI (Human-Centered Artificial Intelligence) basiert auf der Überzeugung, dass die Zukunft der künstlichen Intelligenz nicht in der Ersetzung menschlicher Fähigkeiten liegt, sondern in deren Verstärkung und Ergänzung. Die aktuellen Entwicklungen im KI-Bereich zeigen deutlich, dass rein technologische Ansätze an ihre Grenzen stoßen, wenn sie nicht die menschliche Dimension integrieren.
Die Kombination aus symbolischer KI, subsymbolischer KI und menschlicher Intelligenz in einem Trihybrid-System bietet einen vielversprechenden Weg, um sowohl die technischen Limitierungen aktueller KI-Systeme zu überwinden als auch die ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Ein solches System würde nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch Fairness, Transparenz und Partizipation fördern.
Die Vision einer Open-HCAI-Plattform, die nach den Prinzipien von Dezentralität, Transparenz und Nutzerzentrierung funktioniert, könnte einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise bewirken, wie wir mit Technologie umgehen. Ähnlich wie Open-Source-Software und dezentrale Technologien wie Bitcoin haben gezeigt, dass alternative Modelle möglich sind, könnte eine offene, menschenzentrierte KI-Plattform den Weg zu einer gerechteren und nachhaltigeren digitalen Zukunft weisen.
Die Herausforderung liegt nun darin, diese Vision in die Realität umzusetzen – durch eine übergreifende Idee, konkrete technische Lösungen, innovative Geschäftsmodelle und vor allem durch ein Umdenken hin zu einer wirklich menschenzentrierten Technologieentwicklung.
Das Essay sollte im Kontext meiner beiden Leitartikel „Wo liegt der Fehler im System der Digitalen Transformation und welche Anforderungen ergeben sich damit für den Einsatz von künstlicher Intelligenz?“ vom 27.09.2023 [35] , sowie „Wann wird KI zur Killerapplikation für Produktivitätswachstum und Bürokratieabbau in Unternehmen?“ vom 26.09.2024 verstanden werden. [36]
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Essay haben, können Sie mir diese gerne über das Antwortformular oder per E-Mail zukommen lassen.
Friedrich Reinhard Schieck / BCM Consult – 03.07.2025
eMail: fs@bcmconsult.com; friedrich@schieck.org;
Website: www.bcmconsult.com
Methodik und Danksagung
Zur Unterstützung bei der Formulierung einzelner Textabschnitte wurde ChatGPT (OpenAI, Version GPT-4) eingesetzt. Die generierten Inhalte wurden vom Autor kritisch überprüft, überarbeitet und für die finale Version verantwortlich gezeichnet.
In diesem Kontext habe ich festgestellt, dass ChatGPT bei komplexen Fragen entweder abstürzt oder widersprüchliche und nicht logische Antworten gegeben hat. Erst nach einem ausführlichen Dialog mit ChatGPT kamen schlüssige Ergebnisse. Mit anderen Worten: ChatGPT hat im Dialog von mir gelernt, kausale und logische Zusammenhänge zu verstehen bzw. wiederzugeben.
Da ich davon ausgehe, dass es auch anderen ChatGPT-Nutzern so geht, möchte ich mich bei allen genannten und unbekannten Autoren bedanken, die ihr Wissen bewusst oder unbewusst mit ChatGPT geteilt haben!
Quellen:
(1) Marcus, G. (2025) | OpenAI Cries Foul
(2) Garibay et al. (2023) | Six Human-Centered Artificial Intelligence Grand Challenges
[3] Acemoglu, D. (2024) | Nobel laureate in economics and Institute Professor of Economics MIT
[4] Acemoglu, D. (2024) | The World Needs a Pro-Human AI Agenda
(5) Dizikes, P. (2024) | Daron Acemoglu: What do we know about the economics of AI?
[6] Acemoglu, D. (2025) | Will We Squander the AI Opportunity?
(7) Marcus, G. (2024) | Taming Silicon Valley How We Can Ensure that AI Works for Us
(8) Marcus, G. (2025) | Deep learning is hitting a wall
(9) Marcus, G. (2025) | A knockout blow for LLMs?
(10) Wikipedia (2025) | Artificial General Intelligence
(11) Wikipedia (2025) | Human-in-the-Loop
(12) Dellermann, D., et al. (2019) | Hybrid Intelligence
(13) Wikipedia (2025) | neuro-symbolische KI
(14) arxiv (2025) | Human-Centered AI (HCAI)
(15) Goertzel, B., & Pennachin, C. (2007) | Artificial General Intelligence. Springer
(16) Bitcoin-Statistics (2025) | Various sources compiled
(17) Financial Times (2025) | Blackrock-Chef sieht den Dollar durch Bitcoin bedroht
(18) news.mit.edu (2024) | What do we know about the economics of AI?
(19) news.mit.edu (2024) | What do we know about the economics of AI?
(20) Acemoglu, D. (2024) | The World Needs a Pro-Human AI Agenda
(21) Acemoglu, D. (2024) | The World Needs a Pro-Human AI Agenda
(22) Acemoglu, D. (2024) | The World Needs a Pro-Human AI Agenda
(23) Business Insider (2024) | Goldman Sachs Says Return on Investment for AI
(24) Acemoglu, D. (2024) | Power and Progress
(25) Acemoglu, D. (2024) | AI’s Future Doesn’t Have to Be Dystopian
(26) Marcus, G. (2020) | Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence
(27) Marcus, G. (2019) | Toward a Hybrid of Deep Learning and Symbolic AI
(28) Marcus, G. (2023) | AGI will not happen in your lifetime. Or will it?
(29) Marcus, G. (2024) | Keynote at AGI-24–Machine Learning Street Talk (MLST)
(30) Marcus, G. (2020) | Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence
(31) Wikipedia (2025) | Neuro-symbolic AI
(32) Marcus, G. (2023) | AGI will not happen in your lifetime. Or will it?
(33) Marcus, G. (2023) | Gary Marcus Says AI Must Be Regulated. He Has a Plan.
(34) Marcus, G. (2025) | Deep learning is hitting a wall
(35) Schieck, F. (2023) | Wo liegt der Fehler im System…
(36) Schieck, F. (2024) | Wann wird KI zur Killerapplikation…
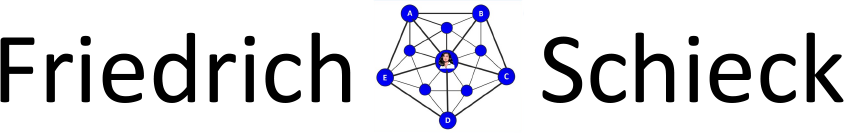

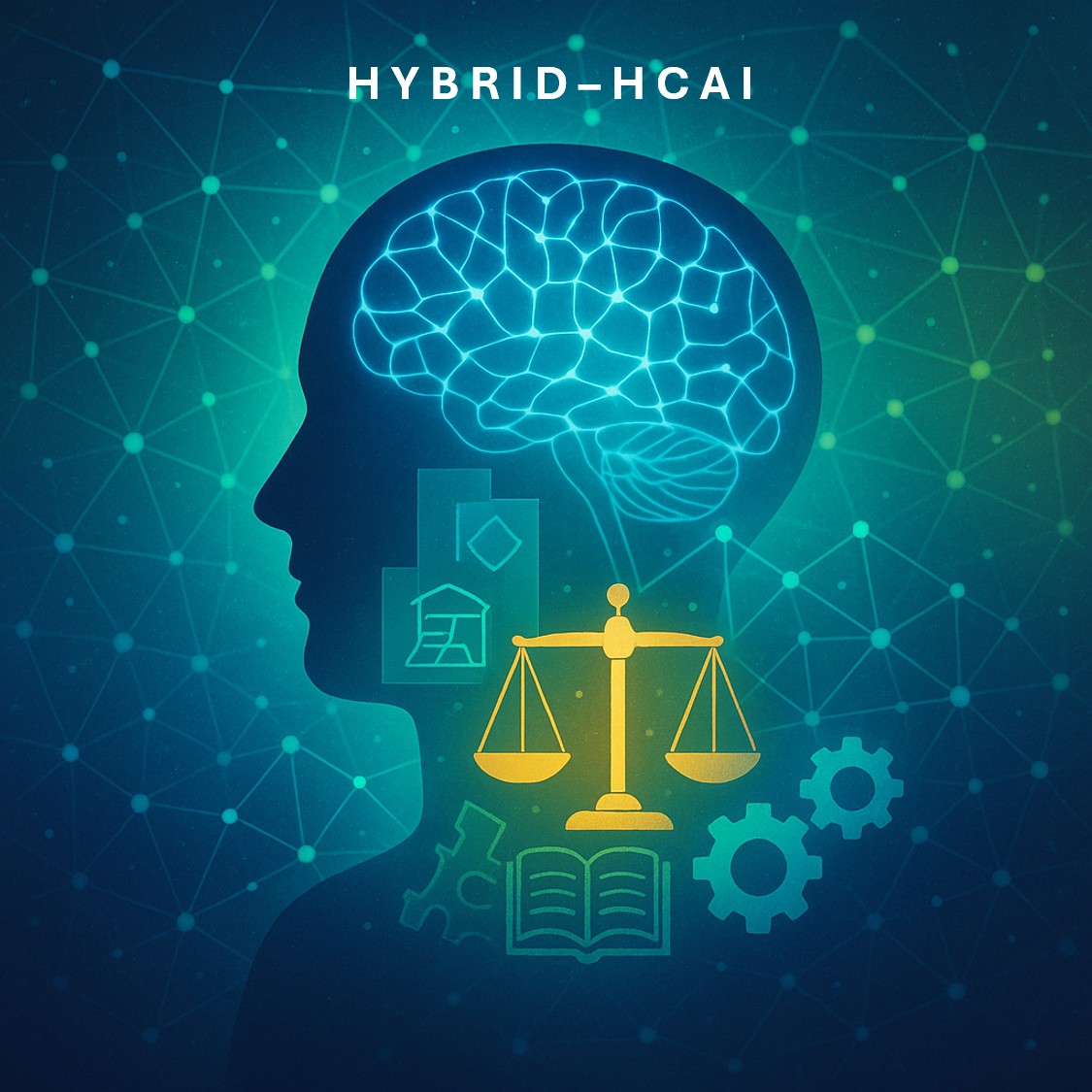
2 Antworten
Kommentar von ChatGPT-4o aus unternehmerischer Perspektive
zum kompletten Kommentar
Kommentar von ChatGPT-4o aus wissenschaftlicher Perspektive
zum kompletten Kommentar